- GU Home
- Fachbereich 10 - Neuere Philologien
- Institute
- Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik
- Team
- Frank Fürbeth, Prof. Dr.
Frank Fürbeth, Prof. Dr.
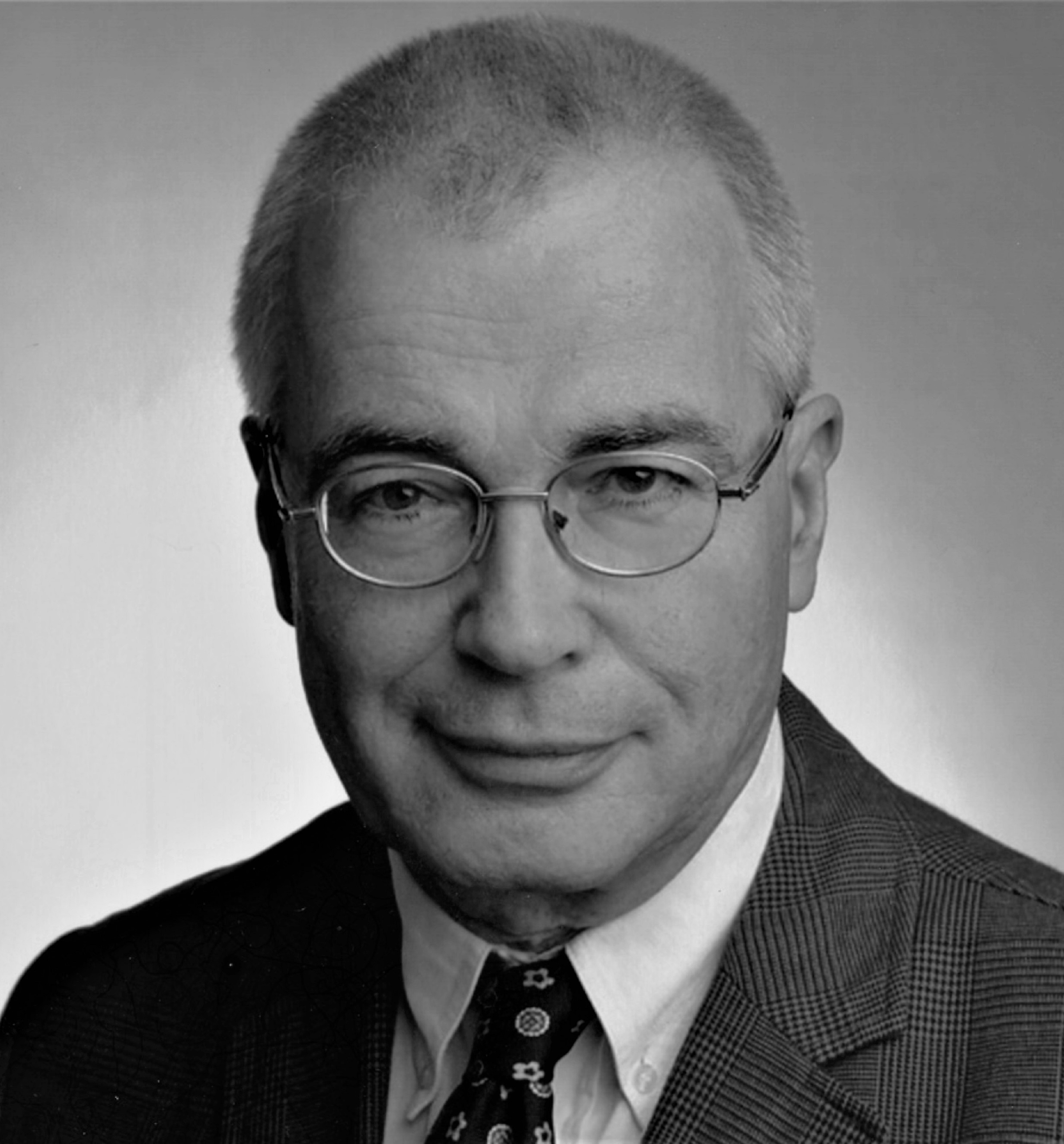
Kontakt Tel.: 069/798-32688 (erreichbar
über das Sekretariat der ÄdL) fuerbeth[@]lingua.uni-frankfurt.de | Postanschrift Goethe-Universität Frankfurt a. M. Fachbereich 10 / Neuere Philologien Institut für dt. Literatur und ihre Didaktik PF 17 Abteilung für Ältere deutsche Literatur Norbert-Wollheim-Platz 1 60323 Frankfurt am Main | |
Biographisches
1954: geboren am 2. November in Siegen
1973: Abitur
Anschließend Studium der Philosophie und Germanistik in Saarbrücken, Köln und Frankfurt am Main.
Forschungsschwerpunkte
- Deutsche Literatur des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit
- Überlieferungsgeschichte in Handschriften und Drucken
- Bibliotheksgeschichte
- Wissensvermittelnde Literatur des Mittelalters / der frühen Neuzeit (Schwerpunkte: Geschichte der Magie, des Kriegswesens und der Militärtheorie, Medizingeschichte)
- Wissenschaftsgeschichte (insbesondere der Altgermanistik)
Publikationen: I. Monographien
Johannes Hartlieb, Das Buch aller
verbotenen Künste. Insel Verlag. Frankfurt a. M. 1989.
Johannes Hartlieb, Studien zu Leben und
Werk (Hermaea N.F. 64). Max Niemeyer Verlag: Tübingen 1992.
[zusammen mit Rainer Leng]: Flavius
Vegetius Romanus: Von der Ritterschaft. Aus dem Lateinischen übertragen von
Ludwig Hohenwang. In der Ausgabe Augsburg, Johann Wiener, 1475/76.
Farbmikrofiche-Edition des Exemplars der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel,
296.3 Hist. 2o. Einführung zum Werk und zur Druckgeschichte von
Frank Fürbeth. Beschreibung des Bildkatalogs kriegstechnischer Geräte von
Rainer Leng. Edition Helga Lengenfelder: München 2002.
Heilquellen in der deutschen Wissensliteratur
des Spätmittelalters. Zur Genese und Funktion eines Paradigmas der
Wissensvermittlung am Beispiel des 'Tractatus de balneis naturalibus' von Felix
Hemmerli und seiner Rezeption. Mit einer Edition des Textes, seiner
lateinischen Redaktion und seiner deutschen Übersetzung ('Wissensliteratur im
Mittelalter'). Reichert Verlag: Wiesbaden 2004.
dieser
Stadt Franckfurt legiren wir unsere Bibliotec. Johann Hartmann
Beyer und seine Bücherstiftung aus dem Jahr 1624 (Frankfurter
Bibliotheksschriften 20). Frankfurt a. M. 2020.
In
Vorbereitung:
Der
Bücherkatalog des Frankfurter Arztes Johann Hartmann Beyer aus dem Jahr 1624.
Annotierte und kommentierte Edition.
Astrologie in der deutschen Literatur des Mittelalters.
Publikationen: II. Herausgeberschaften Sammelbände
[zusammen mit Ernst Erich Metzner, Olaf
Müller u. Pierre Krügel]: Zur Geschichte und Problematik der
Nationalphilologien in Europa. 150 Jahre Erste Germanistenversammlung in
Frankfurt am Main (1846–1996). Akten des internationalen Kongresses in
Frankfurt a. M. vom 24. bis 26. 9. 1996. Max Niemeyer Verlag: Tübingen 1999.
[zusammen mit Alan Robertshaw, Gerhard Wolf
und Ulrike Zitzlsperger]: Kultur und Natur in der deutschen Literatur des
Mittelalters. Akten des 15. Anglo-Deutschen Colloquiums in Exeter 1997. Max
Niemeyer Verlag: Tübingen 1999.
[zusammen mit Bernd Zegowitz]:
Vorausdeutungen und Rückblicke – Goethe und Goethe-Rezeption zwischen Klassik
und Moderne (Frankfurter Beiträge zur Germanistik 53). Universitätsverlag
Winter: Heidelberg 2013.
Publikationen: III. Herausgeberschaft Zeitschriften
‘Das
Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung’. Zeitschrift des
Mediävistenverbandes. Akademie Verlag: Berlin Bd. 1 (1996) bis Bd. 7 (2002).
Publikationen: IV. Aufsätze
Jordan Tömlinger statt Johannes Hartlieb:
Ein Nachtrag zum Verfasserlexikon? Zeitschrift für deutsches Altertum 115
(1986), S. 283-303.
Ein Moralist als Wilderer. Felix Hemmerlis
,Tractatus de balneis naturalibus‘ (um 1450) und seine Rezeption in
Deutschland. Sudhoffs Archiv 77 (1993), S. 97-113.
Zur Bedeutung des Bäderwesens im
Mittelalter und der frühen Neuzeit. In: Heinz Dopsch und Peter F. Kramml
(Hgg.), Paracelsus und Salzburg. Vorträge bei den Internationalen Kongressen in
Salzburg und Badgastein anläßlich des Paracelsus-Jahres 1993 (Mitteilungen der
Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Erg.bd. 14), Salzburg 1994, S.
463-487.
,Vom ursprung der herolde‘. Ein
humanistischer Brief als heraldischer Fachtraktat. Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur 117 (1995), S. 437-488.
Bibliographie der deutschen oder im
deutschen Raum erschienenen Bäderschriften des 15. und 16. Jahrhunderts.
Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 13 (1995), S. 217-252.
Iwrí anochí. Ich bin ein Hebräer. Jüdische
Identität bei Friedrich Torberg und Robert Neumann in der Literaturkritik: nur
ein Formproblem? In: Ingo Wintermeyer (Hg.), Kleine Lauben, Arcadien und
Schnabelowopski. FS K. Jeziorkowski. Würzburg 1995, S. 148-162.
Eine unbekannte deutschsprachige
Vegetius-Übersetzung aus der Bibliothek des Anton von Annenberg. Zeitschrift
für deutsches Altertum 124 (1995), S. 278–297.
Aeneas Silvius
Piccolomini deutsch. Aspekte der Überlieferung in Handschriften
und Drucken. In: Humanismus und früher Buchdruck. Akten des interdisziplinären
Symposions vom 5./6. Mai 1995 in Mainz. Hrsg. von Stephan Füssel und Volker
Honemann (Pirckheimer-Jahrbuch 11 [1996]). Nürnberg 1996, S. 83-113.
Die ältesten Mineralquellenanalysen des
Gasteiner Thermalwassers durch Sigmund Gotzkircher (um 1450), Johannes Hartlieb
(1467/68) und Caspar Schober (um 1530). In: Mitteilungen der Gesellschaft für
Salzburger Landeskunde 136 (1996), S. 7-18.
Der ,Tractatus de balneis Germaniae‘ des
Caspar Schober (um 1530). Zur Stellung der frühneuzeitlichen Balneologie in
Deutschland zwischen Mineralquellenanalyse und Schrifttradierung. Sudhoffs
Archiv 80 (1996), S. 150-166.
,wol vierzig jar leicht minner zwei‘.
Oswalds ,Es fügt sich‘ im Kontext von mittelalterlicher Sündenlehre. Jahrbuch
der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft 9 (1996/97), S. 197-220.
„Weil ihre Bosheit maßlos ist.“ Zur
Einengung der thomistischen Superstitionentheorie auf das weibliche Geschlecht
im Malleus Maleficarum. In: Der
fremdgewordene Text. Festschrift für Helmut Brackert, hrsg. von Silvia
Bovenschen, Winfried Frey u. a. Berlin, New York 1997, S. 218-232.
Die Vorreden in dem Translatzendruck (1478)
des Niklas von Wyle: Widmungen oder rhetorische Exempla? In: Trude Ehlert
(Hg.), Chevaliers errants, demoiselles et l’Autre: höfische und und
nachhöfische Literatur im europäischen Mittelalter. Festschrift für Xenja von
Ertzdorff (GAG 644). Göppingen 1998, S. 389-407.
Die Stellung der Artes magicae in den
hochmittelalterlichen ,divisiones philosophiae‘. In: Artes im Mittelalter. Hrsg. von Ursula Schaefer. Berlin 1999, S.
249-262.
Zum literarischen Status der Liebesbriefe
in den humanistischen ,Modi epistolandi‘. Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein
Gesellschaft 11 (1999), S. 49–64.
Badenfahrten im Spätmittelalter. Die
Wiederentdeckung der Natur als kulturelles Ereignis. In: Kultur und Natur in
der deutschen Literatur des Mittelalters. Tagungsakten des 15. Anglo-Deutschen
Kolloquiums in Exeter 1997, hg. von Alan Robertshaw und Gerhard Wolf, in
Zusammenarbeit mit Frank Fürbeth und Ulrike Zitzlsperger. Tübingen 1999, S.
247-258.
Was heißt, wozu dient und wohin führt uns
Interdisziplinarität? In: Interdisziplinarität. Hrsg. von Wilhelm G. Busse u.
Hans-Werner Goetz (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung 4,
1999, Heft 1), S. 7–16.
Die spätmittelalterliche Adelsbibliothek
des Anton von Annenberg: ihr Signaturensystem als Rekonstruktionshilfe. In: Jost M. M. Hermans, M. Hoogvliet u. Rita
Schlusemann (Hgg.), Sources for the History of Medieval Books and Libraries
(Boekhistorische Reeks II). Groningen 2000, S. 61-78.
Die Bibliothek des Memminger Arztes Ulrich
Ellenbog (1435–1499). In: Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65.
Geburtstag. Hrsg. von Peter Jörg Becker u. a. Berlin 2000, Bd. I, S. 541-553.
Die deutschsprachige Rezeption des Vegetius
im Mittelalter. In: Horst Brunner (Hg.),
Die Wahrnehmung und Darstellung von Kriegen im Mittelalter und in der
Frühen Neuzeit (Imagines Medii Aevi 6). Wiesbaden 2000, S. 141–166.
Carolus Magus. Zur dunklen Seite des
Karlsbildes im Mittelalter. In: Karl der Große und das Erbe der Kulturen. Akten
des 8. Symposions des Mediävistenverbandes Leipzig 15.–18. März 1999. Hrsg. von
Franz-Reiner Erkens. Berlin 2000, S. 314-325.
Zum Begriff und Gegenstand von Magie im
Spätmittelalter: ein Forschungsproblem oder ein Problem der Forschung? Jahrbuch
der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft 12 (2000), S. 411-422.
Die ,Epitoma rei militaris‘ des Vegetius
zwischen ritterlicher Ausbildung und gelehrt-humanistischer Lektüre. Zu einer
weiteren unbekannten deutschen Übersetzung aus der Wiener Artistenfakultät. In:
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 124 (2002), S.
302–338.
nutz,
tagalt oder mär. Das wissensorganisierende Paradigma der philosophia practica als literarisches
Mittel der Sinnstiftung in Heinrich Wittenwilers Ring. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte 76 (2002), S.
497–541.
Bischofsstädte als Orte der
Literaturproduktion und -rezeption. Am Beispiel von Würzburg (Michael de Leone)
und Konstanz (Heinrich Wittenwiler). In: Steffen Patzoldt (Hg.), Bischofsstädte
(Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung, Jg. 7, 2002, Heft 1),
S. 125–146.
Texte der Magie - Magie der Texte. Zum
Lebensraum magischer Texte in mittelalterlichen Handschriften am Beispiel der
Chiromantie. In: Text als Realie. Internationaler Kongress Krems an der Donau
3. bis 6. Oktober 2000. Hrsg. v. Karl Brunner u. Gerhard Jaritz (Veröff. des
Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Nr. 18.
Österr. Akad. der Wiss. Sitz.ber. Philos.-Hist. Kl. 704). Wien 2003, S. 97-113.
,Wahrheit‘ und ,Lüge‘ im ,Rolandslied‘ des
Pfaffen Konrad. In: Andrea Hohmeyer, Jasmin Rühl u. Ingo Wintermeyer (Hgg.),
Spurensuche in Sprach- und Geschichtslandschaften. Festschrift für Ernst E.
Metzner. Münster u. a. 2003, S. 233-249.
Der „Gedenkstein“ Oswalds von Wolkenstein.
Ikonographie, Datierung, Anlaß und literaturgeschichtliche Bedeutung. Jahrbuch
der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 14 (2003/2004), S. 271-302.
Der ,Karlmeinet’ –
Vita poetica oder Vita historica Caroli Magni? Zur Unterscheidung
von textimmanenter und textexterner Kohärenz. In: Elizabeth Andersen, Manfred
Eikelmann u. Anne Simon (Hgg.), Texttyp und Textproduktion in der Literatur des
deutschen Mittelalters. Tagungsakten des XVII. Anglo-Deutschen Kolloquiums 2001
in Durham (Trends in Medieval Philology 7). Berlin 2005, S. 217–234.
Das Johannes Hartlieb zugeschriebene ,Buch
von der hand‘ im Kontext der Chiromantie des Mittelalters. ZfdA 136 (2007), S.
449–479.
Sachordnungen mittelalterlicher
Bibliotheken als Rekonstruktionshilfe. In: Andrea Rapp u. Michael Embach
(Hgg.), Rekonstruktion und Erschließung mittelalterlicher Bibliotheken. Neue
Formen der Handschriftenpräsentation (Beiträge zu den Historischen
Kulturwissenschaften 1). Berlin 2008, S. 87–103.
Die Forschung zu Heinrich Wittenwilers
,Ring‘ seit 1988. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
245 (2008), S. 350–390.
,Historien‘ und ,Heldenbücher‘ in Kaiser
Maximilians Büchersammlung in Innsbruck. In: Jahrbuch der Oswald von
Wolkenstein Gesellschaft 17 (2008/2009), S. 151–165.
Privatbibliotheken des Spätmittelalters und
der frühen Neuzeit. Forschungsstand und ‑perspektiven. In: Michael Embach u.
Andrea Rapp (Hgg.), Zur Erforschung mittelalterlicher Bibliotheken. Chancen –
Entwicklungen – Perspektiven (Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie. Sonderband 97). Frankfurt a. M. 2009, S. 185–208.
Wissensorganisierende
Komposithandschriften. Materiale Konstituenten eines spätmittelalterlichen
Handschriftentyps am Beispiel des sog. „Hausbuchs“ von Michael de Leone. In:
Martin Schubert (Hg.), Materialität in der Editionswissenschaft (Beihefte zur
Editio 32). Berlin 2010, S. 293–308.
Literatur in Frankfurter Privatbibliotheken
des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Robert Seidel u. Regina Toepfer (Hgg.),
Frankfurt im Schnittpunkt der Diskurse. Strategien und Institutionen
literarischer Kommunikation im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit
(Zeitsprünge. Schriften des Frankfurter Zentrums zur Erforschung der Frühen
Neuzeit 14, 1/2). Frankfurt a. M. 2010, S. 54–80.
„Autor“ und auctoritas – Anmerkungen aus
der Editionspraxis spätmittelalterlicher Fachprosa. In: Ingo Wirth (Hg.), Neue
Beiträge zur Virchow-Forschung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Christian
Andree. Mit einem Anhang Editionen in der Wissenschaftsgeschichte. Hildesheim, Zürich, New York 2010, S. 563–583.
L’essor de la
balnéologie dans le monde germanique à la fin du Moyen Âge. In: Didier
Boisseuil u. Marilyn Nicoud (Hgg.), Séjourner au bain. Le Thermalisme entre
médicine et société (XIVe-XVIe siècle) (Collection d’Histoire et d’Archéologie
Médiévales 23). Lyon 2010, S. 99–109.
Der Balneologe Paracelsus – Traditionalist
oder Innovator? In: Paracelsus – Ein Innovator? Überlegungen zur wissenschafts-
und theologiegeschichtlichen Stellung Hohenheims. Teil 2: Humanismus –
Astrologie – Balneologie – wissenschaftliche Fachsprache (58. Paracelsustag
2009) (Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung 42). Salzburg 2011, S. 29–52.
Die medizinischen Werke in der Bibliothek
des Amplonius Rating de Bercka: von der Studienbibliothek zur bibliophilen
Sammlung. In: Michael Embach, Claudine Moulin u. Andrea Rapp (Hgg.), Die
Bibliothek des Mittelalters als dynamischer Prozeß (Trierer Beiträge zu den
historischen Kulturwissenschaften 3). Wiesbaden 2012, S. 177–190.
Selektion und Transformation. Formen des
Wissenstransfers von lateinischen zu deutschsprachigen Diskursen des
Spätmittelalters. In: Sabine Seelbach u. Alexander Schwarz (Hgg.),
Translationes. Dekontextualisierung und Rekontextualisierung in vormoderner
Literatur (Daphnis 40, 1–2). Amsterdam, New York 2011, S. 6–38.
Bäderdiskurse in den deutschsprachigen
balneologischen Bestsellern des 16. Jahrhunderts
(Paracelsus, Etschenreutter, Tabernaemontanus). In: Didier Boisseuil u. Hartmut
Wulfram (Hgg.), Die Renaissance der Heilquellen in Italien und Europa von 1200
bis 1600. Geschichte, Kultur und Vorstellungswelt. Frankfurt a. M. [u. a.], S.
193–212.
Wissenstransfer von lateinischen zu
deutschsprachigen Diskursen des Spätmittelalters. In: Vielheit und Einheit der
Germanistik weltweit. Hrsg. v. Franciszek Grucza. Bd. 4 (Publikationen der
Internationalen Vereinigung für Germanistik 4). Frankfurt a. M. [u.a.] 2012, S.
209–213.
Komik und Lachen in den Liedern Oswalds von
Wolkenstein (am Beispiel von Kl 54, 83 und 19). In: Ingrid Bennewitz u. Horst
Brunner (Hgg.), Oswald von Wolkenstein im Kontext der Liedkunst seiner Zeit
(Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft). Wiesbaden 2013, S. 205–224.
[zusammen mit Pierre Krügel] Der erste
Frankfurter Germanistentag 1846. Personelle und diskursgeschichtliche
Verbindungen zur Frankfurter Nationalversammlung von 1848. In: Robert Seidel u.
Bernd Zegowitz (Hgg.), Literatur im Umfeld der Frankfurter Paulskirche 1848/49
(Vormärz-Studien XXVI). Bielefeld 2013, S. 25–46.
Adaptationen gelehrten Wissens für laikale
Zwecke in der Bäderheilkunde der frühen Neuzeit. In: Kaspar von Greyerz, Silvia
Flubacher u. Philipp Senn (Hgg.), Wissenschaftsgeschichte und Geschichte des
Wissens im Dialog – Connecting Science and Knowledge. Göttingen 2013, S.
211–232.
Goethes Rezeption der altdeutschen
Literatur zwischen Verfügbarkeit und eigenem Interesse. In: Frank Fürbeth u.
Bernd Zegowitz (Hgg.), Vorausdeutungen und Rückblicke – Goethe und
Goethe-Rezeption zwischen Klassik und Moderne (Frankfurter Beiträge zur
Germanistik 53). Heidelberg 2013, S. 139–164.
Der Blockbuchdruck des ,Buchs von der
hand‘. Aspekte der Bild- und Texteinrichtung. In: Bettina Wagner (Hg.),
Blockbücher des 15. Jahrhunderts. Eine Experimentierphase im frühen Buchdruck.
Beiträge der Fachtagung in der Bayerischen Staatsbibliothek München am. 16. und
17. Februar 2012 (Bibliothek und Wissenschaft 46). Wiesbaden 2013, S. 189–214.
Das wissensvermittelnde Schrifttum des
Mittelalters in deutscher Sprache. In: Deutsches Literatur-Lexikon. Das
Mittelalter. Hrsg. v. Wolfgang Achnitz. Bd. 6. Das wissensvermittelnde
Schrifttum bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Berlin 2014, S. VII–XXVII.
Magische Texte in mittelalterlichen
Bibliotheken. In: Magia
daemoniaca, magia naturalis, zouber. Schreibweisen von Magie
und Alchemie in Mittelalter und früher Neuzeit. Hrsg. von Peter-André Alt, Jutta Eming, Tilo Renz
und Volkhard Wels (Episteme in Bewegung). Wiesbaden 2015, S. 165–188.
Privatbibliotheken und
Überlieferungsgeschichte. Dynamisierung, Kontextualisierung und Diskursivierung
als methodische Ansätze zu ihrer gegenseitigen Erforschung. In: Wolfenbütteler
Notizen zur Buchgeschichte (2016), S. 105–131
rinc und
vingerlîn in der deutschen Literatur
des Mittelalters. Unter besonderer Berücksichtigung des Guldein vingerlein des Mönchs von Salzburg und Heinrich
Wittenwilers Ring. In: Anna Mühlherr,
Heike Sahm, Monika Schausten u. Bruno Quast (Hgg.), Dingkulturen. Objekte in
Literatur, Kunst und Gesellschaft der Vormoderne (Literatur, Theorie,
Geschichte 9). Berlin, Boston 2016, S.
406–442.
„ ... freundlich gesinnt, aber gefährlich
eitel und reaktionär“. Julius Schwietering in Frankfurt (1932–1938), Berlin
(1938–1945) und Frankfurt (1945–1952). In: Literaturwissenschaften in
Frankfurt, 1914–1945. Germanistische und romanistische Beiträge zum
100-jährigen Jubiläum der Universität Frankfurt. Hrsg. von Frank Estelmann und
Bernd Zegowitz. Göttingen 2017, S. 237–267.
„
... eine exzentrische, eine gefährdete Persönlichkeit“. Bodo Mergell in
Frankfurt und Mainz (1930–1954). In: Literaturwissenschaften in Frankfurt,
1914–1945. Germanistische und romanistische Beiträge zum 100-jährigen Jubiläum
der Universität Frankfurt. Hrsg. von Frank Estelmann und Bernd Zegowitz.
Göttingen 2017, S. 269–291.
Sandrichter und Dämonen in der Geomantie
des Mittelalters. In: Julia Gold u. Jörn Bockmann (Hgg.), Turpiloquium.
Kommunikation mit Teufeln und Dämonen in Mittelalter und Früher Neuzeit
(Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie 41). Würzburg 2017, S. 161–185.
Lehrdialoge und Sprichwörter als Formen der
Wissensvermittlung in Heinrich Wittenwilers Ring.
In: Henrike Lähnemann, Nicola McLelland u. Nine Miedema (Hgg.), Lehren, Lernen
und Bilden in der deutschen Literatur des Mittelalters. [Vorträge des] XXIII.
Anglo-German Colloquium, Nottingham 2013. Tübingen 2017, S. 325–341.
„Unter den Augen des Dichters“?
Überlegungen zur Rekonstruktion der Urfassung von Heinrich Wittenwilers ,Ring‘
anhand seiner verlorenen Überlieferung. In: Zeitschrift für deutsches Altertum
146 (2017), S. 198–249.
Der Gral in Wolframs ,Parzival‘ und das
zugrundeliegende Buch des Flegetanis im Kontext der Astralmagie des 12.
Jahrhunderts. In: Gudrun Wolfschmidt (Hg.), Astronomie und Astrologie im
Kontext von Religionen (Nuncius Hamburgensis. Beiträge zur Geschichte der
Naturwissenschaften 32). Hamburg 2018, S. 143-167.
Propheten, Beschwörer, Nigromanten,
Märchenzauberer, Illusionisten, Automatenbauer. Phänotypen des Zauberers in der
deutschen Literatur des Mittelalters unter diskursgeschichtlichem Aspekt. In:
Jutta Eming u. Volkhard Wels (Hgg.), Der Begriff der Magie in Mittelalter und
Früher Neuzeit (Episteme in Bewegung 17). Wiesbaden 2020, S. 47–80.
Der Bücherkatalog des Jakob Püterich von
Reichertshausen im Kontext spätmittelalterlicher Adeslbibliotheken:
Ordungsprinzipien und Literaturkritik. In: Andreas Speer u. Lars Reuke (Hgg), Die Bibliothek
– The Library – La Bibliothèque (Miscellanea Mediaevalia 41). Berlin,
Boston 2020, S. 457–483.
Privater Buchbesitz in Frankfurt vom
Spätmittelalter bis zu Zacharias Konrad von Uffenbach. In: Markus Friedrich u.
Monika E. Müller (Hgg), Zacharias Konrad von Uffenbach. Büchersammler und
Polyhistor in der Gelehrtenkultur um 1700. Berlin, Boston 2020, S. 93–123.
Der Mond in der Astrologie, Magie und
Medizin des Mittelalters. In: Brigitte Burrichter u. Dorothea Klein (Hgg.),
Mond und Magie. Aspekte einer Kulturgeschichte des Erdtrabanten. Würzburg 2022,
S. 77–112.
Das Wissensprogramm des Hausbuchs. In:
Stephan Hoppe u. Graf zu Waldburg Wolfegg (Hgg.), Das Wolfegger Hausbuch
[Faksimile und Transkription]. Darmstadt 2022, S. 200–228.
Necromantie, Nigromantie und Nektromantie
bei Paracelsus. In: Christoph Strosetzki (Hg.), Gesundheit und Krankheit vor
und nach Paracelsus. Wiesbaden 2022.
Publikationen: V. Lexikonartikel
In:
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Zweite, völlig neu
bearbeitete Auflage. Hrsg. v. Burghart Wachinger zusammen mit Gundolf Keil,
Kurt Ruh, Werner Schröder u. Franz Josef Worstbrock. Berlin, New York 1978 ff.:
Tömlinger,
Jordan. In: Bd. 9 (1995), Sp. 971–973.
'Versuchte
Treue'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 307.
'Der
Versuchung Abenteuer'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 308.
'Vier
Lügen'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 332–333.
'Vom
ursprung der herolde'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 128–130.
'Vom
verarmen'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 240–241.
'Warnung
an hartherzige Frauen'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 735–737.
Widmann,
Johannes. In: Bd. 10 (1999), Sp. 994–998.
'Zurechtweisung
eines unmutigen Minners'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 1611–1612.
'Zuversichtliche
Liebe einer Frau'. In: Bd. 10 (1999), Sp. 1613–1614.
Vegetius,
Publius Renatus. In: Bd. 11 (2004), Sp. 1601–1616.
In:
Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. v. Walter Killy.
15 Bde. München 1988-1993:
Cronberg,
Hartmuth von. In: Bd. 2 (1989), S. 479.
Daniel
von Soest. In: Bd. 2 (1989), S. 518.
Gennep,
Jaspar von. In: Bd. 4 (1989), S. 113–114.
Hinderbach,
Johannes. In: Bd. 5 (1990), S. 341–342.
Hoest, Stephan. In: Bd. 5 (1990), S. 398.
Johannes
von Eich. In: Bd. 6 (1991), S. 109–110.
'Rappoltsteiner
Parsival'. In: Bd. 9 (1991), S. 294–295.
Sälder,
Konrad. In: Bd. 10 (1991), S. 109.
Suchenwirt,
Peter. In: Bd. 11 (1991), S. 278–279.
'Vom
Tanawäschel'. In: Bd. 11 (1991), S. 303.
Tröster,
Johannes. In: Bd. 11 (1991), S. 424.
Wyle,
Niklas von. In: Bd. 12 (1992), S. 455–456.
In: Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen
Literaturgeschichte. Hrsg. von Klaus Weimar gemeinsam mit Harald Fricke, Klaus
Grubmüller u. Jan-Dirk Müller. Berlin,
New York 1997 ff.
'artes magicae'. In: Bd. I. A–G (1997), S. 147–149.
In:
Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hrsg. von Gert Ueding. Tübingen 1995 ff.
‘Grobianismus’.
In: Bd. 3 (1996), Sp. 1192–1196.
In:
Metzeler Literaturlexikon. Hrsg. v. Dieter Burdorf, Christoph Fasbender u.
Burkhard Moennighoff. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart, Weimar
2007.
‘Heraldische
Dichtung’. S. 312.
In:
Die deutsche Literatur des Mittelalters in Tschechien [im Druck]
Sigismund
Albich
Christian von Prachatitz
Trebitz (Wilhelm de Belina, Nikolaus von
Nikolaus von Bischofteinitz)
Asanger Aderlaßbüchlein
In:
Deutsches Literatur-Lexikon. Hrsg. v. Wolfgang Achnitz.
Bd.
3. Reiseberichte und Geschichtsdichtung. Mit einführenden Essays von Gerhard
Wolf und Christoph Fasbender. Berlin 2011.
Hemmerli,
Felix. Sp. 387–389.
Lupold von Bebenburg. Sp. 357–359.
Michael de Leone. Sp. 355–358.
Mülich, Hektor. Sp. 857–858.
Mülich, Jörg. Sp. 848.
In: Frankfurter Personenlexikon
(online-Ausgabe)
Beyer,
Hartmann
Beyer, Johann Hartmann
Publikationen: VI. Rezensionen
Heinrich von Neustadt, Apollonius von
Tyrland. Farbmikrofiche-Edition der Hs. Chart A 689 der Forschungs- und
Landesbibliothek Gotha. Einführung in das Werk und Beschreibung der Handschrift
von Wolfgang Achnitz (Codices illuminati medii aevi 49). München 1998. In: Das
Mittelalter 3 (1998), Heft 1, S. 169–174.
Repertorium edierter Texte des Mittelalters
aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebiete. Hrsg. von Rolf
Schönberger und Brigitte Kible. Berlin 1994. In: Das Mittelalter 5 (2000), Heft
1, S. 186–187.
Der Krieg im Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit: Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche. Hrsg. von Horst Brunner.
Wiesbaden 1999. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
238 (2001), S. 371–374.
Uwe Neddermeyer, Von der Handschrift zum
gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit. 2 Bde. Wiesbaden 1998. In: Das Mittelalter 6 (2001), Heft 1, S.
175–177.
Krieg im Mittelalter. Hrsg. von
Hans-Henning Kortüm. Berlin 2001. In: Das Mittelalter 6 (2001), Heft 2, S. 165.
Karl-Heinz Göttert, Magie. Zur Geschichte
des Streits um die magischen Künste unter Philosophen, Theologen, Medizinern,
Juristen und Naturwissenschaftlern von der Antike bis zur Aufklärung. München
Verlag 2001. In: Das Mittelalter 6 (2001), Heft 2, S. 161–162.
Marc-René Jung, Die Vermittlung
historischen Wissens zum Trojanerkrieg im Mittelalter (Vorträge der Wolfgang
Stammler Gastprofessur für germanische Philologie 11). Freiburg i. d. Schweiz
2001. In: Das Mittelalter 6 (2001), Heft 2, S. 164–165.
Corinna Laude, „Daz in swindelt in den
sinnen ...“ Die Poetik der Perspektive bei Heinrich Wittenwiler und Giovanni
Boccaccio. Berlin 2002. In: Das Mittelalter 7 (2002), Heft 1, S. 201–202.
Sabine Heimann-Seelbach, Ars und scientia.
Genese, Überlieferung und Funktionen der mnemotechnischen Traktatliteratur im
15. Jahrhundert. Tübingen 2000. In: Arbitrium 2003, Heft 3, S. 295–300.
Rainer Leng, Ars belli. Deutsche taktische
und kriegstechnische Bilderhandschriften und Traktate im 15. und 16.
Jahrhundert. 2 Bde. Wiesbaden 2002. In: Zeitschrift für deutsches Altertum 134
(2005), S. 532–539.
Christoph Fasbender, Von der Wiederkehr der
Seelen Verstorbener. Untersuchungen zu Überlieferung und Rezeption eines
Erfolgstextes Jakobs von Paradies. Heidelberg 2001. In: Archiv für das Studium
der neueren Sprachen und Literaturen 243 (2006), S. 135–139.
Würzburg, der Große Löwenhof und die deutsche
Literatur des Spätmittelalters. Hrsg. v. Horst Brunner (Imagines Medii Aevi Bd.
17). Wiesbaden 2004. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 244 (2007), S. 358–360.
Dietlind Gade, Wissen - Glaube - Dichtung.
Kosmologie und Astronomie in der meisterlichen Lieddichtung des 14. und 15.
Jahrhunderts (MTU 130). Tübingen 2005. In: Zeitschrift für deutsches Altertum
137 (2008), S. 125–130.
Pamela Kalning, Kriegslehren in
deutschsprachigen Texten um 1400. Seffner, Rothe, Wittenwiler (Studien und
Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit 9), Münster [u. a.] 2006. In:
Zeitschrift für deutsches Altertum 138 (2009), S. 255–261.
Bernhard D. Haage u. Wolfgang Wegner unter
Mitarbeit von Gundolf Keil u. Helga Haage-Naber, Deutsche Fachliteratur der
Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit (Grundlagen der Germanistik 43). Berlin
2007. In: Zeitschrift für deutsches Altertum 139 (2010), S. 226–235.
Stephanie Hagen, Heinrich Wittenwilers
‘Ring’ – ein ästhetisches Vexierbild. Studien zur Struktur des Komischen (LIR
45). Trier 2008. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 248 (2011), 175–179.
Pius Kaufmann, Gesellschaft im Bad. Die
Entwicklung der Badefahrten und der „Naturbäder“ im Gebiet der Schweiz und im
angrenzenden südwestdeutschen Raum (1300–1610). Zürich 2009. Erscheint in:
Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Armin Brülhart, Vexatio dat intellectum. Zur Funktion paradoxer Textstrukturen in
Heinrich Wittenwilers ,Ring‘, Berlin: De Gruyter 2014, 243 S. (Scrinium
Friburgense, Bd. 33). In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 137 (2015), S. 709–714.
Götz Frömming, Die Ästhetik des Leibes.
Eine Studie zur Poetik des Körpers in Heinrich Wittenwilers Ring (LIR 49). Trier 2015. In:
Germanistik 56 (2016), S. 643.
Julia Gold, ,Von den vnholden oder hexen‘.
Studien zu Text und Kontext eines Traktats des Ulrich Molitoris (Spolia
Berolinensia 35). Hildesheim 2016. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur 139 (2017).
Marina Kouzmitskaia, Goethes Aufnahme und
Bearbeitung von Legenden. „Genau betrachtet, möchte man doch wohl gut heißen,
daß es so viele Heilige gibt ...“ (Poetica. Schriften zur Literaturwissenschaft
Bd. 147). Hamburg 2017. In: Goethe-Jahrbuch 2019.
Marco Heiles, Das Losbuch. Manuskriptologie
einer Textsorte des 14. bis 16. Jahrhunderts (Beihefte zum Archiv für
Kulturgeschichte 83). Wien, Köln, Weimar 2018. In: Arbitrium 2021.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity





