Forschungsschwerpunkt
RELIGIONSPÄDAGOGIK UND DIGITALITÄT
Religionspädagogik in der digitalen Transformation
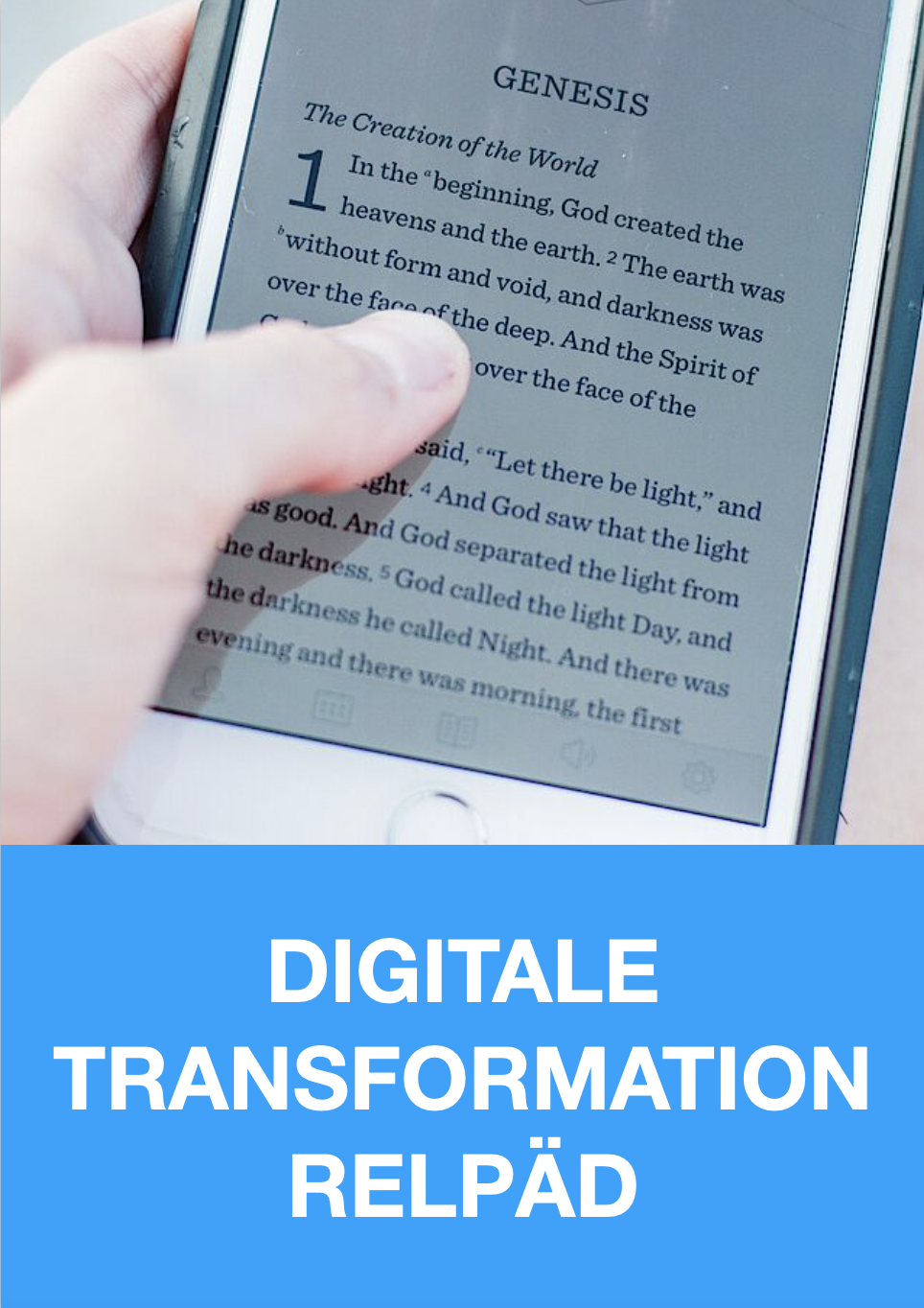
Digitalität ist Trend- und Entwicklungsthema der Bildungslandschaft
Mediatisierung als grundlegende Konstante gesellschaftlichen Wandels prägt die Lebenswelt von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen. Digitalisierung, digital literacy, Medialität, Fiktionalität gelten derzeit als ‚Trending Topics' im Bildungsbereich, nicht erst seit der Herausforderung durch die Corona-Pandemie.
Verstehen Religionspädagogik und Theologie Digitalität bereits als Zeichen der Zeit, werden in den wissenschaftlichen Fächern die grundlegenden Herausforderungen im Kontext von Ethik, Anthropologie, Interaktion, Kommunikation und Bildung erkannt und bedacht? Wie verändern sich Religion, Religiosität und daran anschließend Religiöse Bildung durch Digitalität? Wie hängen eine scheinbar religionsentleerte Lebenswelt mit zutiefst religionshaltigen Nachrichten zusammen? Welches Menschenbild wird in Social Media valorisiert? In Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekten und Publikationen werden Wertebindungen und fachdidaktische Implikationen für eine Religionspädagogik in augmentierter Realität entwickelt.
Aktivität
- RPP-Katholisch – Interview mit Viera Pirker: Ausprobieren und diskutieren. Religionspädagogik in der digitalen Transformation. 10.11.2020.
- „Religiöses Lernen im Horizont der Digitalisierung“: Lehrerbildungstag im Erzbistum Bamberg, 20.05.2020.
- „Religionspädagogik in der digitalen Transformation“. Vortrag bei der Tagung der Pädagogischen Stiftung Cassianeum (dkv, koleischa, akrk), 06.03.2020.
- „social media – Thema und Praxis im Religionsunterricht“, Lehrerfortbildung an der KPH Wien, 09.03.2020.
- Lohrer, Jörg; Pirker, Viera (2020): Religionspädagogik in der digitalen Transformation. Podcast RPI Virtuell. 06.05.2020
- „Digitalität als ‚Zeichen der Zeit'? - theologische Thesen“. Vortrag für Schriftleitertreffen theologischer Zeitschriften, Universität Linz, 22.10.2019.
- „#dnkgtt: Social Media als Kommunikationsort von Religion“. Vortrag an der Universität Freiburg, 10.07.2019.
- „Religion und Social Media“ - Fachgespräch Digitale Religiöse Kommunikation, Theologische Hochschule Chur, 11.05.2019.
- „Du sollst Dir kein Bildnis machen - Die Gottesfrage in Social Media“. Workshop bei der Tagung „Religionspädagogische road-trips zur Gottesfrage“ – 14. Religionspädagogisches Forum der Stiftung Cassianeum, 04.04.2019.
- Repräsentanz und Konstruktion von ‚Wahrheit' auf social media. Impulse für eine identitätsbegleitende Religionspädagogik, Vortrag an der Universität Frankfurt, 28.01.2019.
- Identität, ihre Konstruktion und Religiosität – wo kommt die Wahrheit ins Spiel? Vortrag bei der AKRK, Leitershofen, 14.09.2018.
Lehrveranstaltungen
- Religionspädagogik in Zeiten der Virtualität (HS, Universität Gießen, 2020S)
- „Das Geheimnis im Digitalen – religiöse Bildung in Zeiten augmentierter Realität“ (HS, Universität Wien, 2019W)
- „Religiöse und spirituelle Entwicklung begleiten im Horizont mediatisierter Lebenswelt“ (HS, Universität Duisburg-Essen, 2019S)
Publikationen
- Pirker, Viera (2022): Mehr als funktional orientierter Kompetenzerwerb. Religiöse Bildung im 21. Jahrhundert. In: Arnd Bünker, Christoph Gellner, Jörg Schwaratzki (Hg.): Anders. Bildung. Kirche. Eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft Praktische Theologie Schweiz. St. Gallen, S. 115–126.
- Pirker, Viera (2021): Menschsein im Zeitalter der Digitalität. Online verfügbar unter https://relilab.org/menschsein-im-zeitalter-der-digitalitaet/.
- Pirker, Viera (2021): Religiöse Bildung im Kontext der Digitalität. Ein kritisch-konstruktiver Blick auf die Zukunftsrelevanz. In: Norbert Brieden, Hans Mendl, Oliver Reis, Hanna Roose (Hg.): Digitale Praktiken. Aschaffenburg: Lusa, S. 189–199.
- Pirker, Viera (2021): Spiritualität in der Digitalität. In: RU heute (1), S. 32–35.
- Pirker, Viera (2020): Religionspädagogik in der digitalen Transformation. In: Markus Tomberg und Winfried Verburg (Hg.): RU 4.0. Religiöse Bildung und Digitalisierung. 15. Arbeitsforum Religionspädagogik Donauwörth. Fulda: kidocs, 19-32. Online: urn:nbn:de:0295-opus4-20482
- Pirker, Viera (2020): Religiöse Bildung in Zeiten der Corona-Pandemie. Spiegelungen aus Online-Begegnungen zur Situation von Lehrkräften. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 72 (4), S. 486–501. DOI: 10.1515/zpt-2020-0053.
- Pirker, Viera (2020): Digitalität als ‚Zeichen der Zeit'? In: Theologisch-praktische Quartalsschrift 168 (2), S. 147–155.
- Pirker, Viera (2020): DIGI:Tales about GOD. Religiöse Kommunikation im Netz – Beobachtungen durch das religionspädagogische Kaleidoskop. In: Impulse (2), S. 4–7.
- Pirker, Viera (2020): die 4k neu f.r.a.m.e.n. Religiöse Bildung im 21. Jahrhundert.
- Pirker, Viera (2020): Religionsunterricht remote - eine Spurensuche. In: Theo-Care.
- Pirker, Viera (2020): „Kirche und Digitalität in Zeiten der Corona-Krise“. In: Feinschwarz.
- Pirker, Viera; Freund, Silke (2020): Digitalisierung verändert den Religionsunterricht an beruflichen Schulen! In: Informationen für den Religionsunterricht, S. 6–11.Pirker, Viera (2020): Menschsein im Zeitalter der Digitalität. Perspektiven für religiöse Bildung im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. In: Notizblock 67, S. 5–9.
- Pirker, Viera (2019): „Du sollst Dir kein Bildnis machen“: Die Gottesfrage in Instagram. In: Mirjam Schambeck und Winfried Verburg (Hg.): Roadtrips zur Gottesfrage – Wenn es im Religionsunterricht um Gott geht. München: DKV, 137-151.
- Pirker, Viera (2019): Digitalität wirkt Wandel. Anthropologische, theologische und ethische Aspekte. In: Hanna Fülling und Gernot Mayer (Hg.): Die digitale Revolution und ihre Kinder. Brennpunkte digitaler Ethik. Berlin: EZW (EZW Text, 63), S. 77–94.
- Pirker, Viera (2019): Das Geheimnis im Digitalen. Anthropologie und Ekklesiologie im Zeitalter von Big Data und Künstlicher Intelligenz. In: Stimmen der Zeit 144 (2), S. 133–141.
- Pirker, Viera (2018): Social Media und psychische Gesundheit. Am Beispiel der Identitätskonstruktion auf Instagram. In: Communicatio Socialis 51 (4), S. 467–480. DOI: 10.5771/0010-3497-2018-4-467.
- Pirker, Viera (2018): 22 Monate - ein ganzes Leben. Online verfügbar unter www.feinschwarz.net/22-monate-ein-ganzes-leben/, zuletzt aktualisiert am 16.07.2018.
- Pirker, Viera (2018): #theodigital: Theologie im Terrain des Digitalen. Online verfügbar unter www.feinschwarz.net/theodigital-theologie-im-terrain-des-digitalen/, zuletzt aktualisiert am 26.11.2018.
Virtual Reality als Lernort religiöser Bildung

Die Bildung befindet sich in einem der größten Transformationsmomente der letzten Jahrzehnte. Das Leitmedium „gedrucktes Buch“ wird derzeit zunehmend durch ein neues Leitmedium abgelöst: digital basierte Bildungsmedien. Dies erfordert auch von den Lehrkräften einen veränderten Umgang mit Text und Bild, mit bewegten Bildern, mit der Strukturierung von Inhalten und der Präsentation von Fakten. Im Bereich der Augmentierten und Virtuellen Realität (AR/VR) entwickeln sich digitale Bildungsmedien derzeit auf besonders innovative Weise. In theologischer Perspektive stellen sich grundlegende Fragen zum Zueinander solcher Welten, in denen eine spezifische theologische Expertise erforderlich wird: Die dynamische Verwobenheit von Raum und Nicht-Raum, Körper und Verkörperung, Realität und Fiktionalität, ebenso wie die Verortungen in den Zusammenhängen der Virtualität berühren originär theologische Fragen. Menschen und ihre Beziehungen verändern sich im Kontext von Augmentierungen und Virtualisierungen.
Kooperationen
- Medienzentrum Frankfurt
- Bistum Limburg, Abteilung Schule und Bildung
Aktivitäten
- „Voluntary submission? Reflections on the use of virtual reality in religious education teaching“. Vortrag von Viera Pirker im Rahmen der Konferenz „Tyranny and Freedom. Theology in times of crisis“, 28. Theologisches Forum der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Split, 27.-28.10.2022.
- „Transdenzierungen – Überschreitungen. Interdisziplinäre Erkundungen zu AR/VR“, (Online-Tagung, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 24.-25.09.2021).
Lehrveranstaltungen
- „Transzendierungen – Überschreitungen: VR und religiöse Kommunikation“ (Ringvorlesung mit Übung, 2021W)
- „Online-Räume für den Religionsunterricht gestalten“ (HS, 2021S)
- „Erinnerungsorte des Glaubens. Virtuelle Realität im (Hoch)Schulunterricht“, in Kooperation mit der Professur für Kirchengeschichte (HS, Universität Frankfurt, 2020W)
Publikationen
- Käbisch, David; Pirker, Viera, Virtuelle Realitäten, ambivalente Narrative und fiktive Entscheidungssituationen. Konturen einer neuen Erinnerungspädagogik zum Judentum (in Vorbereitung für 2023).
- Pišonić, Klara (13.12.2022): Virtualni posjet Betlehemu, In: Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Online verfügbar unter: https://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/component/edocman/3133-virtualni-posjet-betlehemu
- Pirker, Viera; Pišonić, Klara (Hg.) (2022): Virtuelle Realität und Transzendenz. Theologische und didaktische Erkundungen. Freiburg: Herder.
- Pirker, Viera; Pišonić, Klara (Hg.) (2022): Virtuelle Realität zwischen Transzendenz und Transzendierungen. Zur Einleitung. In: Viera Pirker und Klara Pišonić (Hg.): Virtuelle Realität und Transzendenz. Theologische und didaktische Erkundungen. Freiburg: Herder, S. 7–17.
- Pirker, Viera (2022): Every Body Electric - Mediendidaktische Orientierungen zu Körper und Erfahrung im virtuellen Raum. In: Viera Pirker und Klara Pišonić (Hg.): Virtuelle Realität und Transzendenz. Theologische und didaktische Erkundungen. Freiburg: Herder, S. 29–45.
- Pišonić, Klara (2022): Vom Avatar zur Immersion. Virtual Reality im (Hoch)Schulunterricht. In: Viera Pirker und Klara Pišonić (Hg.): Virtuelle Realität und Transzendenz. Theologische und didaktische Erkundungen. Freiburg: Herder, S. 152–169.
- Pišonić, Klara, Virtualna stvarnost. Novi pristup vizualizacije i imaginacije u vjeronauku [Virtual reality - A new approach to visualization and imagination in religious education]. In: Crkva u svijetu 57 (2022) 1, S. 135–150. Doi: https://doi.org/10.34075/cs.57.1.6
- Pirker, Viera; Pišonić, Klara (2022): Zum Einsatz von Virtual Reality in der Kirchengeschichtsdidaktik – Lernen digital erweitern. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 74 (3), S. 310–324. DOI: 10.1515/zpt-2022-0035.
- Pisonic, Klara (15.09.2021): Kirchengeschichtsdidaktik mit VR. In: relilab.org. Online verfügbar unter: https://relilab.org/kirchengeschichtsdidaktik-mit-vr/.
- Pirker, Viera (2020): Virtuelle Welten. In: Ulrich Kropač und Ulrich Riegel (Hg.): Handbuch Religionsdidaktik. Stuttgart: Kohlhammer, S. 381–387.
Ansprechpartnerin
- Klara Pisonic (E-Mail: pisonic@em.uni-frankfurt.de)
- Viera Pirker
TiRU - Tablets im Religionsunterricht

Die Goethe-Universität hat in der Programmlinie QuiS des Landes Hessen mit ihrem Projektantrag „Erfolgreich Lehren und Lernen – Vielfalt und Internationales im Studium“ (ELLVIS) erfolgreich Mittel eingeworben. Das Projekt ELLVIS hat die Steigerung von Lehrqualität, das Adressieren von Heterogenität, Diversität und Inklusion sowie eine Förderung der Internationalisierung des Studiums und der Lehre zum Ziel. TiRU ist ein neues Teilprojekt im Rahmen der ELLVIS-Linie, mit dem das Engagement für Diversity und Barrierefreiheit als Querschnittsthemen in der Lehre an der Goethe-Universität gestärkt wird.
Förderung
- Erfolgreich Lehren und Lernen – Vielfalt und Internationales im Studium
- Zeit für Lehre (2023S)
Aktivität
- Vortrag bei der DivDig-Tagung an der Universität Bamberg: Das Potenzial von OER für eine diversitätssensible Hochschullehre - Modellprojekt "TiRU", Viera Pirker, Prof. für Religionspädagogik und Mediendidaktik, Goethe-Universität Frankfurt am Main., Paula Paschke, Projektmitarbeiterin (5.-6. Oktober 2023).
Lehrveranstaltungen
- RU in Tabletklassen (WiSe 22/23)
- Biblisches Lernen in Tabletklassen des RU (SoSe 23)
- Moralisches Lernen in Tabletklassen des RU (WiSe 23/24)
Publikationen
- Folgt
Ansprechpartnerin
- Paula Paschke (E-Mail: paschke@em.uni-frankfurt.de)
- Viera Pirker
REAL - Religious education as augmented learning

Die digitale Transformation ist eine allumfassende Entwicklung, die auch das Klassenzimmer betrifft. So formuliert die Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung der digitalen Welt, dass sowohl die Entwicklung als auch der Erwerb von Kompetenzen in einer digitalen Welt unabdingbar sind und eine Querschnittsaufgabe aller Unterrichtsfächer darstellen.
Gerade im Religionsunterricht sind Themenstellungen und digitale Praktiken auf unterschiedliche Art und Weise zugänglich und möglich. Hier eröffnet sich auf Basis religionssensibler und weltanschaulich positionaler Bildung ein großer Explorations- und Handlungsspielraum, für den innovative Wege der Forschung und Begleitung gebahnt werden. Hier setzt REAL an. Ausgehend von der Lebenswelt der Schüler:innen, die Teil dieser Wandlungsprozesse sind, wird der Religionsunterricht unter domänenspezifischen und mediendidaktischen Aspekten untersucht und weitergedacht.
Derzeit besteht eine explorative Untersuchung in Vorbereitung zu der Frage, wie sich die Symboldidaktik innerhalb der Religionspädagogik entwickelt.
Laufzeit
- seit 11/2021
Aktivitäten
Publikationen
Ansprechpartnerin
- Viera Pirker
Forschungsschwerpunkt
VISUELLE RELIGIONSKULTUREN
Kunst der Gegenwart und Film als Medien religiöser Bildung
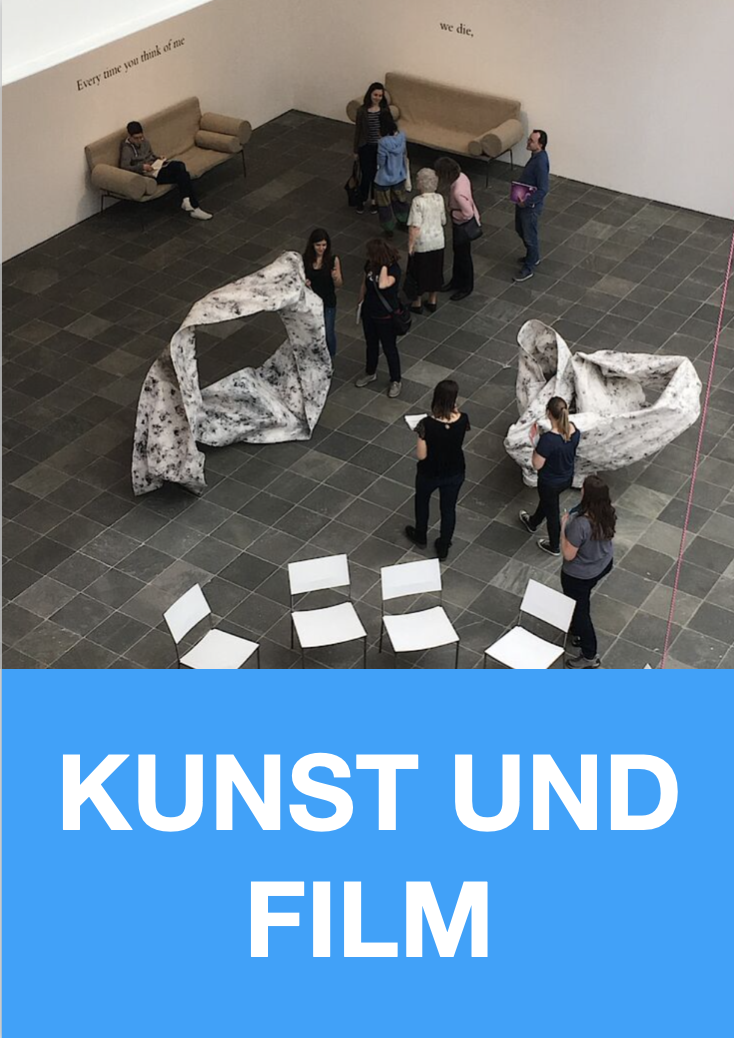
In kontinuierlichen Begleitungen, Begehungen und Erschließungen zu bildender Kunst der Gegenwart, vorrangig in internationalen Großausstellungen wie der Documenta oder der Biennale von Venedig, sowie in Analyse und Erschließung von aktuellen Kinofilmen (arthouse) und von Ausstellungen in Museen und Kirchen wird die Entwicklung religiöser und säkularer Bildsprachen beobachtet und religionspädagogisch fruchtbar gemacht. In Begehungen mit Studierenden im Rahmen von Lehrveranstaltungen erfolgen religionsdidaktische Erschließungen. Studierende erweitern auf diesem Wege ihre Wahrnehmungs- und Deutekompetenz für anthropologische und theologische Fragestellungen im öffentlichen, säkularen Raum der Gegenwart.
Kooperationen
- Internationale Forschungsgruppe „Film und Theologie“
- Prof. Dr. Joachim Valentin, Professur für christliche Religions- und Kulturtheorie der Goethe-Universität
- Arbeitsstelle „Religiöse Bildkompetenz und Bilddidaktik“ der Universität Dortmund
- Prof. Dr. Annegret Reese-Schnitker, Professorin für Religionspädagogik der Universität Kassel
Aktivität
- Lernen im Lumbung – Religion und Wirtschaftsethik bei der Documenta fifteen. Kooperation mit Prof. Dr. Annegret Reese-Schnitker und Prof. Dr. Bernhard Emunds (HS, Goethe-Universität, Universität Kassel, Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen, 2022S)
- Konferenz „Abschiede und Aufbrüche – das Alter im Film, Katholische Akademie Schwerte, 15.-18.06.2022.
- Konferenz „Christliche Identität in der Krise“ der Forschergruppe „Film und Theologie“, Katholische Akademie Schwerte, 02.-05.06.2021.
- „Thomas Bayrle: Zündstoff – Religion und Medialität“. Aschermittwoch der Künstler im Bistum Limburg, Haus am Dom Frankfurt, 06.03.2019. (invited) https://www.youtube.com/watch?v=YMjmd4Q3NMU
- Religion lernen mit Kunst der Gegenwart (HS, Universität Wien, 2017S)
- Kirchenraumpädagogik Kooperation mit Dr. Peter Scheuchenpflug (HS, Universität Wien, 2017S)
- „Fließende Phänomene: Religionspädagogik und Medialisierung“. Vortrag beim Kongress „Religionspädagogik ökumenisch: gemeinsame Herausforderungen und unterschiedliche Perspektiven“ von AKRK und GwR, Hildesheim, 13.09.2014.
- „Partizipative Kunst im Religionsunterricht der Sek I“. Vortrag beim DFG-Netzwerk „Funktion und Wirkweisen von Kunst im Religionsunterricht“, 02./03.03.2012, Köln.
- Documenta 14 – Kunst der Gegenwart als Anlass religiösen Lernens? Kooperation mit Prof. Dr. Annegret Reese-Schnitker (HS, Universität Kassel, 2012S)
- „fare mondi – Welten machen: Religionspädagogische Entdeckungen zu partizipativer zeitgenössischer Kunst“. Vortrag bei der Tagung „Vergessene Zusammenhänge – notwendige Entdeckungen. Auf der Suche nach einer Religionspädagogik, die an der Zeit ist“ der AKRK, Augsburg, 28.09.2010.
- Kunst der Gegenwart und religiöses Lernen - Fachdidaktik ästhetisch und kreativ (HS, Universität Graz, 2016S)
- Die dOCUMENTA (13): Kunst der Gegenwart als Anlass religiösen Lernens, Koop. mit Prof. Dr. Annegret Reese-Schnitker (HS, PTH Sankt Georgen und Universität Kassel, 2012S)
Publikationen
- Pirker, Viera; Valentin, Joachim (Hg.) (2023): Kirche, Kult und Krise – das Christentum im neueren Film. Marburg: Schüren (Religion – Film – Media).
- Pirker, Viera (2022): Maria von Magdala als barmherzige Samariterin? Ein Film als theologiegenerativer Ort. In: Christian Fröhling, Jakob Mertesacker, Viera Pirker und Theresia Strunk (Hg.): Wagnis Mensch werden. eine theologisch-praktische Anthropologie. Festschrift für Klaus Kießling zum 60. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht; S. 294–306.
- Pirker, Viera (2022): Sexuelle und geistliche Gewalt durch Kleriker. Aktualisierung und Erweiterung der kommentierten Filmographie. In: Joachim Valentin und Karsten Visarius (Hg.): Die Faszination des Bösen. Ein filmisches Panorama. Marburg: Schüren (Religion - Film - Media, 5), 217-250.
- Pirker, Viera (2022): Documenta fifteen - ein kritischer harvest. Feinschwarz. Online verfügbar unter https://www.feinschwarz.net/documenta-fifteen-ein-kritischer-harvest/.
- Lederle, Josef (2021): Christliche Identität in der Krise. Ein Gespräch mit der Theologin Viera Pirker über die Filmtagung „Christliche Identität in der Krise“. Filmdienst. Online verfügbar unter https://www.filmdienst.de/artikel/48242/filmtagung-christliche-identitat-in-der-krise.
- Pirker, Viera (2021): Filmarbeit in der Pastoral. In: Die Deutschen Bischöfe (Hg.): Katholische Filmarbeit: Theologisch-pastorale Leitgedanken – Praxisfelder – Kultureller Stellenwert, Bonn, S. 16–29.
- Pirker, Viera (2021): Fotografie als Übergang in eine andere Welt. Shana und Robert ParkeHarrison. In: Katechetische Blätter 146 (1), S. 56–60.
- Pirker, Viera (2020): Was die Stunde schlägt. Eine ästhetisch-theologische Zeitansage mit Kunst. Feinschwarz.Online verfügbar unter: https://www.feinschwarz.net/was-die-stunde-schlaegt-aesthetisch-theologische-zeitansage/ .
- Pirker, Viera (2020): "Ein verborgenes Leben" (Terrence Malick). Kino als Katharsis. Online verfügbar unter: https://www.feinschwarz.net/ein-verborgenes-leben-kino-als-katharsis .
- Pirker, Viera (2019): Die Zukunft ist unnatürlich. Theologische Erkundungen zur Venedig-Biennale. Online verfügbar unter: https://www.feinschwarz.net/die-zukunft-ist-unnatuerlich-biennale/
- Pirker, Viera (2019): "Gelobt sei Gott"? sexuelle Gewalt und fragile Männlichkeit. Online verfügbar unter: https://www.feinschwarz.net/gelobt-sei-gott-sexuelle-gewalt-und-fragile-maennlichkeit/,
- Pirker, Viera (2018) "Die Erscheinung", oder: wie kommt die Wahrheit in die Welt? [zu Xavier Giannoli (2018), L'Apparition] In: Film-Dienst 72 (2018), 20 Absätze. Online verfügbar unter: https://www.filmdienst.de/artikel/14929/die-erscheinung-oder-wie-kommt-die-wahrheit-in-die-welt.
- Maria Magdalena. Ein christlich-jüdisches Filmgespräch. In: Dialog - DuSiach. Christlich-jüdische Informationen 113 (2018), S. 16–33. Mit Sarah Egger.
- Pirker, Viera (2019): Maria Magdalena: Ein Jesusfilm über die apostola apostolorum. In: Katechetische Blätter 144 (2), S. 150–153.
- Pirker, Viera (2018): Eine himmlische Speisung im Hier und Jetzt. Zur visuellen Exegese der Werke von Tintoretto in San Giorgio Maggiore. In: Sandra Hübenthal und Melanie Peetz (Hg.): Ästhetik, sinnlicher Genuss und gute Manieren. Ein biblisches Menü in 25 Gängen. FS Winfried Jüngling. Frankfurt a.M.: Peter Lang (Österreichische Biblische Studien (ÖBS), 50), S. 263–282.
- Pirker, Viera (2018): „Maria Magdalena“: die Hebamme des Glaubens. Online verfügbar unter: www.feinschwarz.net/maria-magdalena-die-hebamme-des-glaubens/,
- Pirker, Viera (2018): Ein starkes Narrativ: Wim Wenders porträtiert Papst Franziskus. Online verfügbar unter: www.feinschwarz.net/starkes-narrativ-wim-wenders-franziskus,.
- Lauber-Gansterer, Agathe; Pirker, Viera (2018): „In den Gängen“ – sehenswerter Film in den Kinos. Online verfügbar unter: www.erzdioezese-wien.at/site/home/nachrichten/article/66281.html,
- Pirker, Viera (2017): Anatomia del Miracolo - ein Himmel voller Wunder. Online verfügbar unter: www.feinschwarz.net/anatomia-del-miracolo-ein-himmel-voller-wunder,
- Pirker, Viera (2017): Documenta 14 in Kassel - theologische Sichtachsen. Online verfügbar unter: www.feinschwarz.net/documenta_14_in_kassel_theologische_sichtachsen/, zuletzt aktualisiert am 03.07.2017.
- Pirker, Viera (2017): Gegenwartskünstler reagieren auf Religion: Eine Horizonterweiterung für religiöse Bildung. In: ÖRF 26 (1), S. 126–138. Online verfügbar unter www.oerf-journal.eu/index.php/oerf/article/view/128.
- Pirker, Viera (2017): Seht, ein Mensch: Der Christus von Aulhausen. In: Katechetische Blätter 142 (4), S. 270–273.
- Pirker, Viera (2017): "Silence" - in den Dunkelkammern des Christentums. Filmbesprechung zu Martin Scorsese. Online verfügbar unter: www.feinschwarz.net/silence-in-den-dunkelkammern-des-christentums/,
- Pirker, Viera (2017): Unter der Oberfläche: theologischer Streifzug durch die Kunstbiennale von Venedig. Online verfügbar unter: www.feinschwarz.net/unter-der-oberflaeche-theologischer-streifzug-durch-die-kunstbiennale-von-venedig/.
- Pirker, Viera (2016): Unter dem Herzen. Maria Gravida. Online verfügbar unter: www.feinschwarz.net/unter-dem-herzen-maria-gravida/
- Pirker, Viera (2016): Durchs Fenster in die Kirche. Kunst im Kirchenraum erschließen - Inspirationen aus der Kirchenraumpädagogik (Jahrgänge 9/10). In: Rellis (1), S. 34–37.
- Pirker, Viera (2014): Fließende Phänomene. Zeitgenössische Kunst als Inspirator religiöser Bildung. Vortrag bei der gemeinsamen Tagung der Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik sowie der Gesellschaft für wissenschaftliche Religionspädagogik. In: theo-web 13 (2), S. 102–116. Online verfügbar unter www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2014-02/13.pdf.
- Pirker, Viera (2014): Eine Ikone des 20. Jahrhunderts: "Night Hawks" von Edward Hopper. In: Katechetische Blätter 139 (1), S. 31–35.
- Pirker, Viera (2013): Die Freiheit der Kunst. Zum Ausstellungsprogramm in Sankt Georgen. In: Georg 2 (1), S. 47–51.
Religion und Religiosität auf Instagram

Unter den Bedingungen von digitalen Plattformen geschieht informelle religiöse Bildung, durch Menschen, die sich selbst als religiös verstehen, und durch Institutionen, die diese Plattform für ihre Botschaft nutzen. Die hoch interaktive und rasch wachsende digitale Plattform Instagram ist längst religiös, kirchlich und katechetisch besiedelt, jedoch bislang eine Brachfläche religionspädagogischer Reflexion.
In der Beforschung dieser konkreten Plattform stellen sich komplexe Fragen der Inszenierung, Bildkommunikation, Textstrategien und Interaktionen. Welche Bildstrategien wählen katholische Influencer*innen, und wie geschieht eine Verknüpfung mit Text und Botschaft? Welche informellen Lernwege werden hier beschritten? Wie verbindet sich das Medium der Plattform selbst mit der Modellierung von Religion? Wie unterscheidet sich die Repräsentation katholischer Konfessionalität von einer religionspädagogisch reflektierten Konzeption? Eine Ausweitung auf weitere Konfessionen und Religionen ist angedacht.
Kooperationen
- Interdisziplinäre Forschungsplattform „Mediatised Lifeworlds: Young people's narrative constructions, connections and appropriations“ (#youthmedialife), Universität Wien
- Fachgruppe Visuelle Kommunikation der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
- Rebibi – Arbeitsstelle Religiöse Bildkompetenz und Bilddidaktik der TU Dortmund
Aktivitäten
- Tagung: Instagram und Religion. Plattform, Content, User, Praxis. Onlinetagung, 3.2.2023.
- Instagram im Religionsunterricht, Arbeitskreis am Don-Bosco-Tag, Limburg, 19. Februar 2020
- Pirker, Viera; Seelhofer, Udo (2020): Was sind eigentlich Christfluencer? Studio Omega - der Podcast (55). LINK: https://studio-omega-der-podcast.simplecast.com/episodes/folge-55-was-sind-eigentlich-christfluencer . „Visuelle Religionskulturen online“, Gastvortrag an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Innsbruck, 08.01.2020.
- „Visuelle Religionskulturen“, Vortrag an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, 27.11.2019.
- „Christsein – Aufbruch oder Krise? Inszenierung, Repräsentation und Praxis von Religiosität in Social Media“, Fachgespräch: Prospektive Glaubenskultur – Zur Zukunft des Christseins, Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Wien, 13.09.2019.
- „Bilder als Bedeutungsträger. Qualitative Forschung zu Instagram am Beispiel religiöser Influencerinnen“, Vortrag bei der Forschungsplattform #youthmediatizedlifeworlds, Universität Wien, 11.04.2019.
- „Katholisch, weiblich, Instagram. Religionspädagogik in einer mediatisierten Lebenswelt“. Vortrag am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Universität Gießen, 06.02.2019.
- „Creating Catholicism on Instagram“. Vortrag bei der Tagung „Vernetzte Bilder. Visuelle Kommunikation in Sozialen Medien“, DGPuK-Fachgruppe Visuelle Kommunikation, 29.11.-1.12.2018, Universität Wien.
- „Fließende Phänomene: Religionspädagogik und Medialisierung“. Vortrag beim Kongress „Religionspädagogik ökumenisch: gemeinsame Herausforderungen und unterschiedliche Perspektiven“ von AKRK und GwR, Hildesheim, 13.09.2014
Publikationen
- Pirker, Viera; Paschke, Paula (Hg.) (2023, in Vorbereitung): Religion auf Instagram. Plattform – Content – User – Praxis, Freiburg: Herder.
- Pirker, Viera (2021): Zur Macht der Bilder. Theologische Anthropologie im Kontext digitaler Bildkulturen. In: Wolfgang Beck, Ilona Nord und Joachim Valentin (Hg.): Theologie und Digitalität. Ein Kompendium. Freiburg: Herder, S. 155–179.
- Pirker, Viera (2021): Influencing - ein Modell religionspädagogisch reflektierten Handelns? In: International Journal of Practical Theology 25 (1), 40-57. DOI: 10.1515/ijpt-2019-0043.
- Pirker, Viera (2020): „#monthoftherosary“. Theologische Rekonstruktion zu einem Instagram Image. In: Limina 4 (1), S. 192–216. DOI: 10.25364/17.3:2020.2.10.
- Pirker, Viera (2020): Konstruktion von Katholizität durch Frauen auf Instagram. Eine theologisch informierte Einzelbildanalyse. In: Cornelia Brantner, Katharina Lobinger, Gerit Götzenbrucker und Maria Schreiber (Hg.): Vernetzte Bilder. Visuelle Kommunikation in Medien. Köln: Herbert von Halem, 44-63.
- Pirker, Viera (2019): Repräsentanz und Konstruktion von 'Wahrheit' auf Social Media: Impulse für eine identitätsbegleitende Religionspädagogik. In: Religionspädagogische Beiträge 81, S. 31–42.
- Pirker, Viera (2019): Fragilitätssensible Pastoralanthropologie. Impulse aus Praktiken der (Selbst-)Inszenierung in Social Media. In: Zeitschrift für Pastoraltheologie 39 (1), 43-58.
- Pirker, Viera (2019): Gebetsgemeinschaft heute: Katholische Praxis in den Instagram Stories. In: MERZ Medien + Erziehung 63 (3), S. 24–31.
- Pirker, Viera (2019): Katholisch, weiblich, Instagram. Einblicke in plattformspezifische Praktiken. In: Communicatio Socialis 52 (1), S. 96–112. DOI: 10.5771/0010-3497-2019-1-96.
- Pirker, Viera (2018): Identität und Inszenierung auf Instagram. In: Katechetische Blätter 143 (3), S. 179–183.
Lernen am Kreuzweg
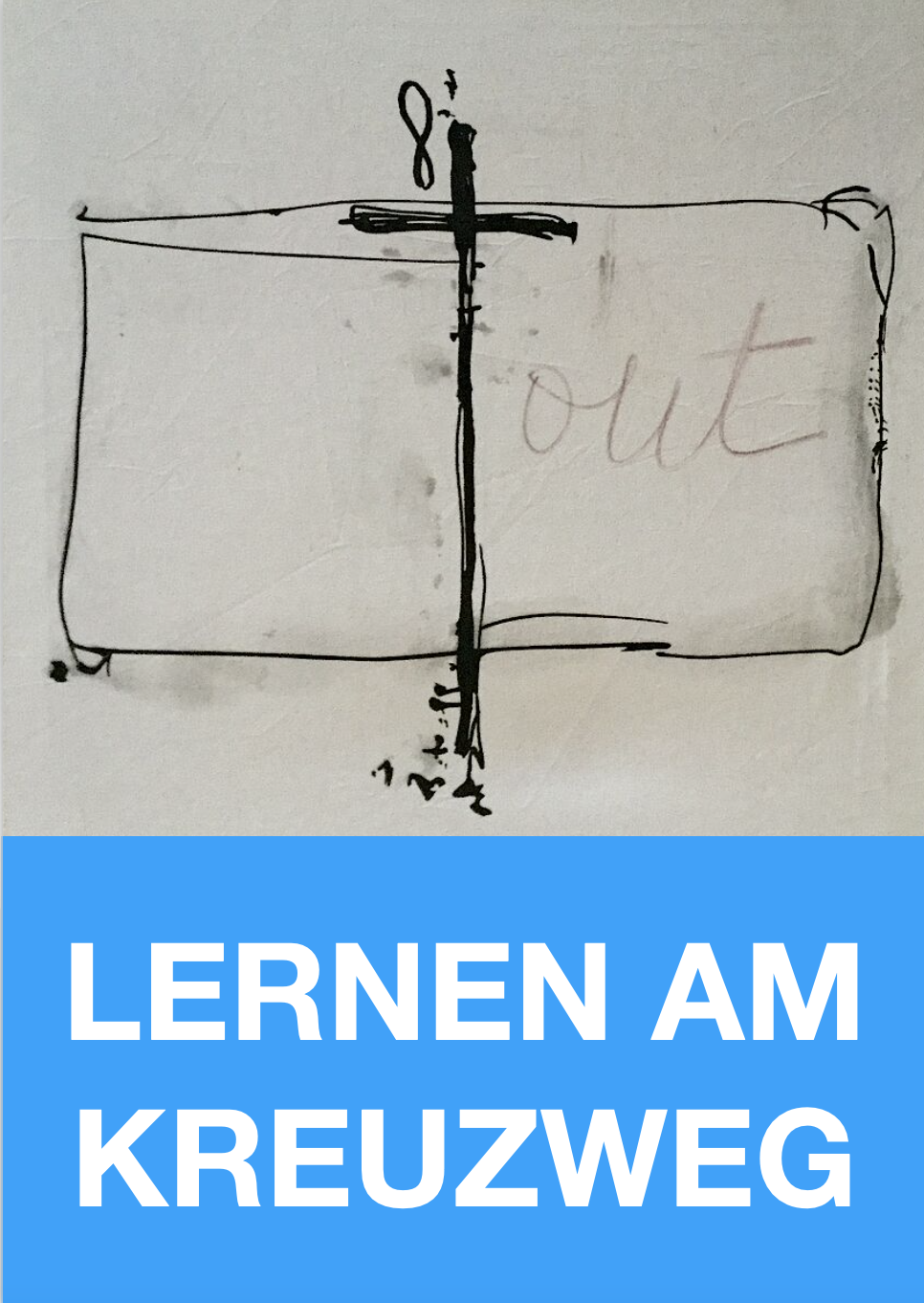
Die Passion Jesu als zutiefst religions- und konfessionshaltige Thematik steht im Zentrum der neutestamentlichen Überlieferung und der Entwicklung des Christentums und hat einen wesentlichen Anteil an religiöser, konfessioneller Bildung. Doch gilt die Passion Lehrkräften als schwieriges Thema im Religionsunterricht, zu dem der Kreuzweg einen möglichen Zugang bildet. Wie bringen Lehrkräfte diesen Unterrichtsgegenstand ein? Wie geschieht im Religionsunterricht die didaktische Operationalisierung durch Lehrkräfte, welche spezifischen religionspädagogischen Grenzziehungen und Positionierungen nehmen sie vor? Was lernen Schüler*innen an diesem Unterricht, welche Voraussetzungen bringen sie mit und wie gehen sie mit konkreten Lernarrangements um? Die qualitativ-empirische Begleitforschung nimmt die Inhaltsdimension des Religionsunterrichts multiperspektivisch in den Blick.
Aktivität
- Lehrkräftefortbildung: Lernen am Kreuzweg: Didaktik der Passion, PH Burgenland (10.03.2020)
- „Unterrichtsbegleitforschung: Ein Blick in (Un-)Tiefen im Projekt ‚Lernen am Kreuzweg: Fallstudien zur Passionsdidaktik'“. Vortrag bei der Tagung der AKRK-Sektion Empirische Religionspädagogik, Nürnberg, 01.-03.03.2018.
- „Der Kreuzweg - Eine fromme Tradition im Spiegel gegenwärtiger Kunst“. Vortrag bei der Theologischen Akademie Wien, Stephansdom, Wien, 15.02.2018.
- „Unterrichtsforschung am Kreuzweg“. Vortrag im Post-Doc-Seminar Praktische Theologie am Institut für Pastoralpsychologie, Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt, 01.12.2017.
- „Jesus Christus“ lernen mit dem Medium Kreuzweg. Jahrestagung „Rendezvous mit der Realität. Religionspädagogischer Umgang mit ausfordernden Zeichen der Zeit“ der AKRK, Leitershofen, 8.-11. 09.2016.
Publikationen
- Mayrhofer, Florian; Pirker, Viera (2023): Bild als Kritik: Image-Kommunikation in einem Unterrichtsprojekt, in: Susanne Reichl; Ute Smit (Hg.). #youthmedialife and friends: Interdisziplinäre Forschung zu mediatisierten Lebenswelten Jugendlicher, Göttingne: Vandenhoeck&Ruprecht.
- Pirker, Viera; Mayrhofer, Florian (2020): „Das Evangelium nach Mika“: Visuell-interaktionale Bibeldidaktik zur Passionserzählung. In: ÖRF (1), S. 99–123. DOI: 10.25364/10.28:2020.1.6 .
- Pirker, Viera (2019): Theologia Passionis – fragmentarische Betrachtungen. In: Volker Sühs (Hg.): Die entscheidenden Fragen der Zukunft. Theologinnen und Theologen nehmen Stellung. Ostfildern: Grünewald, S. 72–78.
- „Jesus Christus“ lernen mit dem Medium Kreuzweg, Poster, AKRK 2016.
Forschungsschwerpunkt
RELIGION, IDENTITÄT UND PLURALITÄT
REDiCON - Religion - Digitality - Confessionality
YouTube ist eine der größten Online-Plattformen, die auch in Deutschland intensiv genutzt wird - und natürlich auch von religiösen Influencer*innen mit user generated content bespielt wird. Das neue Forschungsprojekt REDiCON an der Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik unter der Leitung von Prof. Dr. Viera Pirker befasst sich mit religiösem Influencing und religiöser Kommunikation auf YouTube im deutschsprachigen Raum.
Dabei sollen sowohl Produzent*innen und die Produktion als auch Content und schließlich Rezipient*innen und Rezeption der religiösen Inhalte hinsichtlich konfessorischer Praktiken auf YouTube untersucht werden. Im Fokus steht dabei die systematische Frage, inwiefern in diesem Feld Konfession, Konfessionalität und religiöse Zugehörigkeit neu verhandelt werden - daher der Titel: REDiCON - Religion - Digitality - Confessionality.
Laufzeit
- 2023 - 2026
Förderung
- DFG
- FWF
Kooperationen
- Prof. Dr. Manuel Stetter, Universität Rostock
- Prof. Dr. Anna Neumaier, Universität Bochum
- Dr. Bernhard Lauxmann, Universität Wien
Ansprechpartner*innen
- Viera Pirker
- Julia Winterboer (E-Mail: winterboer@em.uni-frankfurt.de)
ReCoVirA - Religious Communities in the Virtual Age
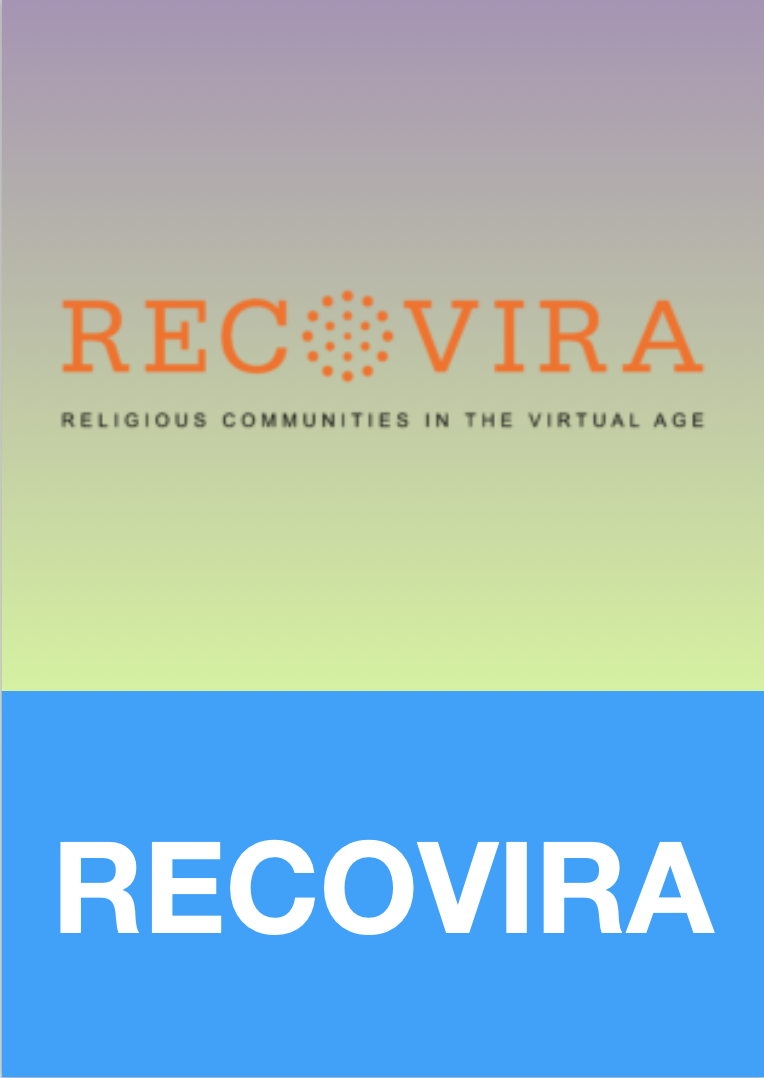
Wie hat sich die Situation für in Deutschland ansässige Religionsgemeinschaften durch die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie mittel- und langfristig verändert? Mit einem empirischen Zugang werden Auswirkungen der Akzeptanz digitaler Technologien in religiösen Gemeinschaften untersucht. Im Zentrum steht die Frage, ob und wie religiöse Gemeinschaften und ihre Rituale für das digitale Zeitalter umgestaltet werden, und welche Rolle ihre öffentliche Positionierung darin spielt. Dies zielt darauf, die Rolle des Digitalen in religiösen Praktiken besser zu verstehen. Zwei Fragen sind leitend:
- Wie haben sich Wesen, Struktur und Erfahrung des religiösen Lebens in Deutschland dadurch verändert, dass religiöse Gemeinschaften etablierte persönliche Zusammenkünfte durch virtuelle Treffen und Elemente der digitalen Kultur ersetzt und ergänzt haben?
- Da die Digitalisierung der religiösen Praxis und des Gemeinschaftslebens zunimmt, wie haben sich die Rollen, die Religion im öffentlichen Leben in Deutschland zukommt, im Verlauf der Pandemie verändert?
Die angenommenen Veränderungen haben zudem Auswirkungen auf die Religionsforschung, in der „Digital Religion“ noch ein Randthema bildet. Mit der Pandemie sind digitale Praktiken ins Zentrum religiösen Handelns gerückt. Im Rahmen des deutschen Teilprojekts werden in ethnographischen Fallstudien drei religiöse Gemeinschaften untersucht. Dies bezieht eine Gemeinschaft der Majorität sowie zwei minoritäre Gemeinschaften ein, die von Migration geprägt sind, und denen unterschiedliche öffentliche Sichtbarkeit zukommt. Die Untersuchung erfolgt in einem europäischen Verbundprojekt, in dem Forschende aus sieben Ländern in einer interdisziplinären und multireligiösen Studie zusammenarbeiten und zusätzlich zu den nationalen Analysen Querschnittsanalysen unternehmen. Die Ergebnisse können in Diskussionen zur sozialpolitischen Praxis in Deutschland und in Europa einfließen, um eine gerechte und humane Religionsausübung in demokratischen Gesellschaften zu fördern.
Laufzeit
- 1. November 2022 – 31. Oktober 2024
Förderung
- Chanse (Horizon 2020 research and innovative programme) www.recovira.org
- Teilprojekt: BMBF, Förderkennzeichen 101004509
Kooperationen
- Dr. Joshua Edelman, Manchester Metropolitan University, Art and Performance, United Kingdom
- Prof. Dr. Lena Roos, Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Sweden
- Prof. Dr. Ewa Stachowska, University of Warsaw, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, Institute of Social Prevention and Resociali, Poland
- Prof. Dr. Ales Crnic, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Slovenia
- Ass. Prof. Dr. Henrik Reintoft Christensen, Aarhus University, School of Culture and Society, dept. of the study of religion, Denmark
- Prof. Dr. Marcus Moberg, Åbo Akademi University, Study of Religions, Faculty of Arts, Psychology and Theology, Finland
- Ass. Prof. Dr. Alana Vincent, Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå universitet, Sweden
Ansprechpartner*innen
- Gero Menzel (E-Mail: Ge.Menzel@em.uni-frankfurt.de)
- Viera Pirker
- Joel Sterzik (E-Mail: joelsterzik@stud.uni-frankfurt.de)
- Henry Cremer (E-Mail: henrycremer@stud.uni-frankfurt.de)
CONTOC - Churches Online in Times of Corona

Der Umgang mit dem Corona-Virus hat die Kirchen und Religionsgemeinschaften international in eine für die Gegenwart vollkommen neue Situation gestellt. Die ökumenisch angelegte Studie erhebt Erfahrungen von Hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in christlichen Gemeinden im Umgang mit den Herausforderungen während der COVID-19-Pandemie. Besonders im Fokus steht die Frage nach den genutzten digitalen Möglichkeiten, darüber hinaus Wahrnehmungen und Anstöße für die Kirchenentwicklung. Diese wurden über Landeskirchen und Diözesen zur Teilnahme an einer Online-Umfrage gewonnen. Der Zeitraum der Befragung Juni – Juli 2020 verspricht einen genauen Einblick in die konkrete Situation der noch akuten, transformativen Phase. Über 1500 Personen aus römisch-katholischen Gemeinden im gesamten Land – Haupt- und Ehrenamtliche, vor allem Pfarrer, Gemeinde- und Pastoralreferent*innen, Diakone und weitere Berufsgruppen haben an der Umfrage teilgenommen.
Laufzeit
- Juni 2020 – Mai 2022
Förderung
- Anschubfinanzierung EU-Projekte (Goethe Universität)
Kooperationen
- Prof. Dr. Wolfgang Beck (Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen)
- Dr. Arnd Bünker, Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut (SPI)
- Dr. Georg Lämmlin (Sozialwissenschaftliches Institut der EKD)
- Prof. Dr. Ilona Nord (Universität Würzburg)
- Prof. Dr. Thomas Schlag / PD Dr. Sabrina Müller, Zentrum für Kirchenentwicklung (ZKE), Universität Zürich
Aktivitäten
- 5. – 6.5.2021 Internationale Tagung CONTOC, Online
- 13.4.2021 Fachtagung CONTOC Deutschland
- 19.10.2020 Background-Gespräch mit Verantwortlichen in katholischen Diözesen
Publikationen
- Wagener, Hermann-Josef; Beck, Wolfgang; Pirker, Viera; Identitätsdimensionen der katholischen pastoralen Hauptamtlichen in Deutschland, in: CONTOC (2023) (im Erscheinen).
- Lämmlin, Georg; Pirker, Viera; Religiöse Kommunikation in der digitalen Gesellschaft – Weiterführende Überlegungen zu kirchlichen Innovationsprozessen, in: CONTOC (2023) (im Erscheinen).
- Adam, Oliver; Deniffel, Jürgen; Mund, Nadine; Nord, Ilona; Pirker, Viera; Rothgangel, Martin; Schlag, Thomas; Bildungsfragen waren von marginaler Bedeutung. CONTOC-Ergebnisse aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, in: CONTOC (2023) (im Erscheinen).
- Pirker, Viera; Horn, Friederike; Eine überfällige Transformation des Kirche. Die qualitative Teilstudie unter katholischen pastoralen Akteur*innen in Deutschland, in: CONTOC (2023) (im Erscheinen).
Identitätssensible Bildung
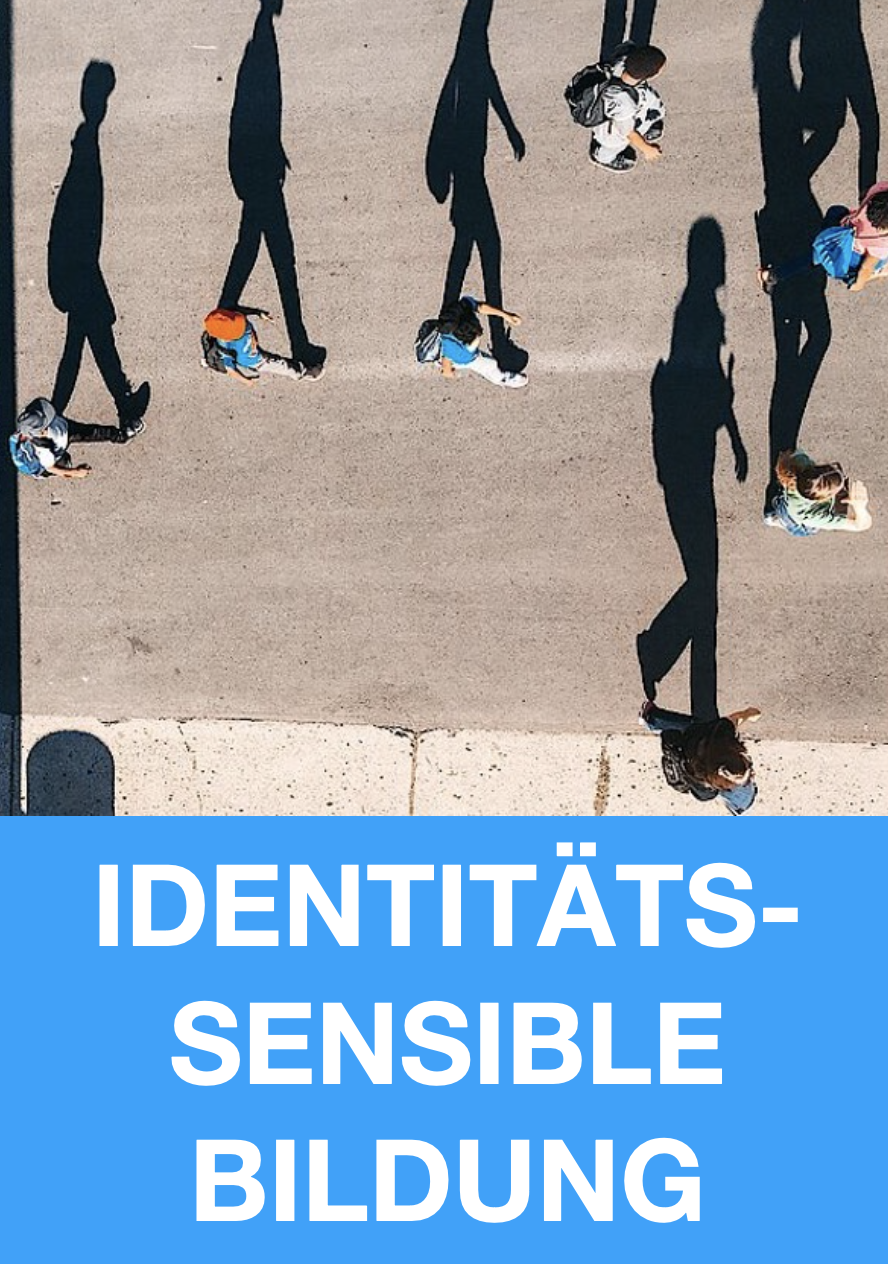
Identität gilt seit Jahrzehnten als Grundbegriff religiöser Bildung und religionspädagogischer Begleitung, doch meist, ohne dass genau geklärt wäre, was mit dem Begriff gemeint sei: Zugehörigkeit, Konfessionalität, Selbstkonzept, Subjektorientierung, Personale Kompetenz, Individualität und Differenzsensibilität lagern sich an den Identitätsbegriff an.
Im Rahmen fortschreitender Auslotungen und Grundüberlegungen zu einem psychologisch und soziologisch informierten, theologisch-anthropologisch gewendeten Nachdenken über Identität entsteht eine Grundlegung von religiöser Bildung: Was gehört zu religiöser Identität? Wie wandeln sich die Begrifflichkeiten, Erfahrungshorizonte und Selbstdeutungen von Menschen, die ihre Identität kontinuierlich konstruieren und weiter entwickeln? Welche Konsequenzen geben sich für Fragen der Ethik und der Fachdidaktik Religion hinsichtlich der Aspekte ethischer Bildung?
- „Abschied vom Fragment. Theologie und Kirche vor der Herausforderung fluider Identität“, Vortrag bei der Tagung: Glaubensbiografien und kirchliche Lebensformen im Umbruch, Theologisches Forschungskolleg der Universität Erfurt, 08.11.2019. (invited)
- „Christsein – Aufbruch oder Krise? Inszenierung, Repräsentation und Praxis von Religiosität in Social Media“, Vortrag zum Fachgespräch: Prospektive Glaubenskultur – zur Zukunft des Christseins, Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Wien, 13.09.2019.
- „Individuelle Konstruktionen professionell religiöser Identität – aus pastoralpsychologischer Sicht“. Vortrag bei der Konferenz „Die sakramentale Grundstruktur der Kirche und ihrer Dienste und Ämter“, Bundesarbeitsgemeinschaft Diakonat (in Kooperation mit DBK, Pastorale Dienste), Katholische Akademie München, 03.04.2019. (invited)
- „Identität, ihre Konstruktion und Religiosität: Wo kommt die Wahrheit im Spiel?“. Vortrag bei der Tagung „Wenn die Wahrheitsfrage ins Spiel kommt. Religiöse Bildung in postfaktischer Zeit“ der AKRK, Augsburg, 13.-16.09.2018. (invited)
- „Was ist Identität? Eine kritisch-theologische Revision neuerer Identitätstheorien“. Vortrag bei der Tagung der AKRK/ESWTR Arbeitsgruppe Religionspädagoginnen, Mainz, 23.-25.02.2018.
- „Fragmente und Fragilitäten: Herausforderungen für religiöses Lernen in der Gegenwart“. Vortrag bei der Tagung: „#fragmentarisch #leben #lernen: Der Beitrag religiöser Bildung zur Identitätsfindung“, Deutscher Katechetenverein, Brixen, Italien, 30.09.2017. (invited)
- „inst@nt identity? Aspekte einer fragilitätssensiblen Pastoralanthropologie“. Vortrag bei der Tagung „#OMG!1elf!! Oh mein Gott: Pastoraltheologie im Zeitalter digitaler Transformation“ der Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologie, Augsburg, Deutschland, 12.09.2017. (invited)
- “Fluid and Fragile, or in between: Christian Identity in Crisis?" Vortrag bei der Tagung “Challenges for Religious Education in Contemporary Society", Katholisch-Theologische Fakultät Split, Kroatien, 26.05.2017. (invited)
- „Identitätsbildung unter den Bedingungen der reflexiven Moderne - am Beispiel der Kirchlichen Anforderungen an die Religionslehrer(innen)bildung in Deutschland“. Statement und Diskussion im Panel „Religiöse Identitätsbildung und Moderne“ der Internationalen Theologischen Studientage, Universität Münster, Kath.-Theol. Fakultät, 09.-12.06.2016. (invited)
- „Glauben, Leben, Lehren - als Beruf? Religionspädagogische Professionalität wissenschaftlich und praktisch betrachtet“. Fachvortrag bei der Jahrestagung des DKV „Follow me: Zur Bedeutung der Lehrenden in religiösen Lernprozessen in Schule und Gemeinde“, Liborianum Paderborn, 27.09.2014. (invited)
- „Bildung und Identitätsentwicklung: Aktuelle Herausforderungen an Schule und RU“. Vortrag vor der Konferenz der Leiter/innen der Schul- und Bildungsabteilungen in den Bistümern (Koleischa), Erbacher Hof, Mainz, 19.03.2014.
- Didaktik der Spiritualität (HS, PTH Sankt Georgen, 2011W)
Lehrveranstaltungen
- Theorien religiöser und spiritueller Entwicklung (VL, Universität Gießen, 2020S)
- Theorien religiöser und spiritueller Entwicklung (VL, Universität Linz, 2020S)
- Alles nur eine Frage der Liebe? Beziehung und Partnerschaft als Lebensthema und Unterrichtsthema, Ethische Bildung, mit Prof. Dr. Gunter Prüller-Jagenteufel (HS, Universität Wien, 2019S)
- Identitätsentwicklung und religiöse Bildung (HS, Universität Wien, 2018S)
- Am Ende des Lebens – das Leben am Ende? Ethische Bildung, mit Prof. Dr. Gunter Prüller-Jagenteufel (HS, Universität Wien, 2017W)
- Identitätsentwicklung und Religiöse Bildung (OS, PTH Sankt Georgen, 2015S)
Publikationen
- Pirker, Viera (2022): Von der Bedeutung der Freundschaft. In: Katechetische Blätter 147 (2), S. 85–88.
- Pirker, Viera (2021): Grenzflächen der Pastoral. Pastoraltheologische Perspektive. In: MDG-Trendmonitor (Hg.): Religiöse Kommunikation 2020/21. Einstellungen, Zielgruppen, Botschaften und Kommunikationskanäle. Freiburg: Herder, S. 390–395.
- Pirker, Viera (2021): Abschied vom Fragment? Theologie und Kirche vor den Herausforderungen fluider Identität. In: Daniel Kosack und u.a. (Hg.): Lebensabschnittspartner? Glaubensbiographien und kirchliche Lebensformen im Umbruch. Würzburg: Echter (Erfurter Theologische Schriften), S . 5–75.
- Pirker, Viera (2020): Individuelle Konstruktionen professionell religiöser Identität. Pastoralpsychologische Blicke. In: Richard Hartmann und Stefan Sander (Hg.): Zeichen und Werkzeug. Die sakramentale Grundstruktur der Kirche und ihrer Dienste und Ämter. Ostfildern: Grünewald, S. 13–29.
- Pirker, Viera (2019): Subjektorientierte religiöse Bildungsprozesse - medial gespiegelt. In: Jan-Hendrik Herbst und Claudia Gärtner (Hg.): Zukunftsperspektiven: Springer, S. 215–232.
- Pirker, Viera (2019): Traditionen im Wandel: Eine identitätspolitische Relecture kirchlicher Dokumente zur Religionslehrer_innenbildung. In: Marianne Heimbach-Steins und Judith Könemann (Hg.): Religiöse Identitäten in einer globalisierten Welt. Münster: Aschendorff (Münsteraner Theologische Studien). (im Erscheinen)
- Pirker, Viera (2018): Identität und Inszenierung auf Instagram. In: Katechetische Blätter 143 (3), S. 179–183.
- Pirker, Viera (2016): Lernen mit der eigenen Biografie in der Religionslehrerbildung: Theoretische Aspekte. In: Religionspädagogische Beiträge 74 (1), S. 56–68.
- Pirker, Viera (2016): Lehrkräfte als Bildungsagent(inn)en? Religionspädagogische Reflexion zum Umgang mit Ausgrenzungsphänomenen in schulischer Bildung. In: Bernhard Grümme und Thomas Schlag (Hg.): Gerechter Religionsunterricht. Religionspädagogische, pädagogische und sozialethische Orientierungen. Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 11), S. 139–154.
- Pirker, Viera (2017): Fluid and Fragile, or in between: Christian Identity in Crisis? Perspectives from Pastoral Psychology. In: Jadranka Garmaz und Alojzije Čondić (Hg.): Challenges to Religious Education in Contemporary Society. Split: Crkve u Swijetu (Teologija, 53), S. 116–131. Online verfügbar unter ojs.kbf.unist.hr/index.php/proceedings/article/view/82/59.
- Pirker, Viera (2015): Identität. In: Burkard Porzelt und Alexander Schimmel (Hg.): Strukturbegriffe der Religionspädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, Julius, S. 38–43.
- Pirker, Viera (2014): Kreativ und solidarisch: Partizipation erproben mit künstlerischen Überkreuzungsstrategien. (+Material auf CD-Rom). In: Rellis (2), 36–41.
- Pirker, Viera (2014): "Wir werden gehetzt": Jugendliche unter dem Druck der Individualisierung. In: Klaus Kießling und Heinz Schmidt (Hg.): Diakonisch Menschen bilden. Motivationen - Grundierungen - Impulse. Stuttgart: Kohlhammer (Diakonie. Bildung – Gestaltung - Organisation, 13), S. 183–204.
- Pirker, Viera (2013): fluide und fragil. Identität als Grundoption zeitsensibler Pastoralpsychologie. Ostfildern: Grünewald (Zeitzeichen, 31).
- Pirker, Viera (2013): Identität als Fokus und Fluchtpunkt Praktischer Theologie. Psychologische und theologische Verbindungslinien. In: Diakonia 44 (2), S. 127–131.
- Pirker, Viera (2013): Kinder der Freiheit – ohne Ressourcen? Sozialethisch bewusster und bildungspolitisch profilierter Religionsunterricht mit Jugendlichen im Prekariat. In: Albert Biesinger, Matthias Gronover, Michael Meyer-Blanck, Andreas Obermann, Joachim Ruopp und Friedrich Schweitzer (Hg.): Gott - Bildung - Arbeit. Zukunft des Berufsschulreligionsunterrichts. München, New York, Münster u.a.: Waxmann (Glaube - Wertebildung - Interreligiosität, 4), S. 95–108.
- Pirker, Viera (2013): Wer hat, dem wird gegeben? Zur bildungspolitischen Problematik der Ressourcen(un)gerechtigkeit in einer identitätsbildenden Religionspädagogik. In: Judith Könemann und Norbert Mette (Hg.): Bildung und Gerechtigkeit?! Warum religiöse Bildung politisch sein muss. Ostfildern: Grünewald (Bildung und Pastoral, 2), S. 67–83.
Leben und Lernen von und mit geflüchteten Menschen
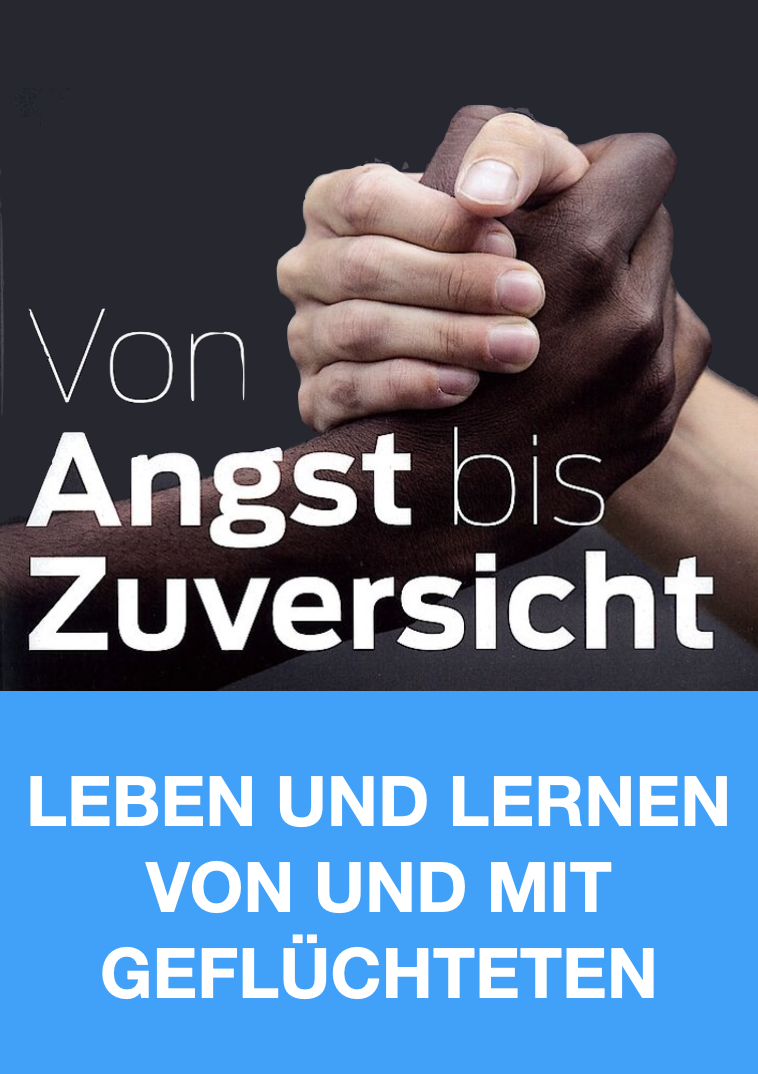
Die Frage nach der sozialen Kohäsion und dem gesellschaftlichen Zusammenleben wird durch Migration nicht ausgelöst, aber zugespitzt. Auf der Suche nach einer inklusiven Gesellschaft, Kirche und Schule, in der es normal ist, verschieden zu sein, zielt die Forschung auf die Identifikation des Beitrags christlicher Gemeinden und Gemeinschaften zum Zusammenleben („Convivenz“), insbesondere von Diaspora- und Migrationsgemeinden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wahrnehmung und dem Umgang mit Differenz, Andersheit und Fremdheit sowie dem Umgang mit Konflikten. Weiters wird erforscht, was und wie Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte voreinander lernen können. Das Projekt erfolgt in Kooperation mit dem Institut für Praktische Theologie, Universität Wien (Prof. Dr. Regina Polak, Prof. Dr. Andrea Lehner-Hartmann)
Aktivitäten
- MIGRATIONSKOMPASS: Von Angst bis Zuversicht, Handbuch und Webportal, Kooperationsprojekt der Fachbereiche Pastoraltheologie und Religionspädagogik
Derzeit entwickeln wir das Webportal www.migrationskompass.eu, das das Handbuch auch als digitales Lehr- und Lernmittel zur Verfügung stellen wird.
- Leben und Lernen von und mit Flüchtlingen: Die Perspektive von ReligionslehrerInnen, Forschungsprojekt zur Entwicklung einer Praxistheorie, Andrea Lehner-Hartmann/Viera Pirker
Die Fluchtbewegungen der letzten Jahre stellen viele Schulen vor große Herausforderungen. Diese zu bestehen, verlangt ein besonderes Engagement von LehrerInnen. Kinder und Jugendliche bringen eigene Flucht- und Migrationserfahrungen mit ins Klassenzimmer. Somit begegnen Lehrkräfte den politischen und persönlichen Megathemen der Gegenwart in ihrem beruflichen Alltag von Mensch zu Mensch.
Was heißt es, mit Flüchtlingen zu leben, sie zu lehren und mit ihnen gemeinsam zu lernen? Dieser Frage geht das Institut für Praktische Theologie der Universität Wien in Kooperation mit dem Institut für Fortbildung Religion und anderen Institutionen nach. Im Fachbereich Religionspädagogik und Katechetik vernetzen ReligionslehrerInnen ihre Erfahrungen hinsichtlich der Herausforderungen, der Hindernisse und Bereicherungen, der Schulentwicklung und der Rolle von Religion in diesem Kontext. Studierende erforschen im Rahmen von fachdidaktischen und forschungsorientierten Seminaren die Frage: Welches ethische Bildungspotenzial entsteht in dieser aktuellen Situation für Menschen, aber auch für Institutionen?
- Leben und Lernen von und mit Flüchtlingen. Forschungsprojekt Pastoraltheologie und Religionspädagogik
Auf der Basis zweier empirischer Forschungsseminare mit FlüchtlingsbegleiterInnen aus zwei katholischen, zwei evangelischen Gemeinden sowie einer islamischen und einer jüdischen Organisation entwickelten die Fachbereiche Pastoraltheologie und Religionspädagogik Thesen zu den Möglichkeiten und Grenzen, Chancen und Probleme des Lebens und Lernens von und mit geflüchteten Menschen. Die Thesen finden Sie ››› hier
Lehrveranstaltungen
- Grundlagen der Religionsdidaktik: am Thema Flucht und Migration (PS, Universität Wien, 2018W)
- Identität, Alterität, Alienität. Interkulturelles Zusammenleben in Migrationsgesellschaften (HS, Donau-Universität Krems, 2018S)
- Aktuelle religionspädagogische Diskurse: Migration und Flucht, mit Andrea Lehner-Hartmann (HS, Universität Wien, 2017S)
- SE Ethische Bildung: Leben und Lernen von und mit Flüchtlingen, mit Andrea Lehner-Hartmann (HS, Universität Wien, 2016W)
Publikationen
- Polak, Regina; Lehner-Hartmann, Andrea; Pirker, Viera (2018): Von Angst bis Zuversicht. Migrationskompass. Leben und Lernen von mit geflüchteten Menschen. Wien.
- Viera Pirker (2018): Flucht und Vielfalt in der Bildungsarbeit. Broschüren, Informationen und Bildungsmaterialien. Digitale Pinnwand, Online verfügbar unter padlet.com/viera_pirker/Flucht_Vielfalt_Bildungsarbeit.
- Lehner-Hartmann, Andrea; Pirker, Viera (2018): Die Bedeutung von Religion in der Arbeit mit geflüchteten SchülerInnen. In: ÖRF 26 (1), S. 46–60. DOI: 10.25364/10.26:2018.1.7.
- Lehner-Hartmann, Andrea; Pirker, Viera (2018): “living with and learning from refugees": Schools in Vienna dealing with global challenges. In: Helmut Kury und Sławomir Redo (Hg.): Refugees and Migrants in Law and Policy – Challenges and Opportunities for Global Civic Education. New York, Heidelberg: Springer, S. 235–260.
- Lehner-Hartmann, Andrea; Pirker, Viera (2017): Religionslehrer*innen und ihr (möglicher) Beitrag zu Integration. In: im Dialog: Schule.Religion.Bildung (12), S. 18–20.
- Pirker, Viera; Reese-Schnitker, Annegret (2018): Migration und Flucht als Themen der Gegenwartskunst. Erkundungen auf der Documenta 14. In: Annegret Reese-Schnitker, Daniel Bertram und Marcel Franzmann (Hg.): Migration, Flucht und Vertreibung. Theologische Analyse und religionsunterrichtliche Praxis. Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 23), S. 99–122.
- Lehner-Hartmann, Andrea; Pirker, Viera (2018): Geflüchtete Jugendliche verändern Schule: Eine Untersuchung zu Alltagserfahrungen von Religionslehrer_innen. In: Annegret Reese-Schnitker, Daniel Bertram und Marcel Franzmann (Hg.): Migration, Flucht und Vertreibung. Theologische Analyse und religionsunterrichtliche Praxis. Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 23), S. 187-206.
Forschungsschwerpunkt
FACHDIDAKTIK RELIGION
- Übersicht
- ReliLab Rhein-Main - Phasenvernetzung in der Lehrkräftebildung
- Pilotprojekt Praxissemester
- REMEMBER - Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht
- Leistungsbeurteilung
- Religiöse Bildung zukunftsfähig gestalten
- Konfessionell kooperativer Religionsunterricht
- Religionsdidaktik und Inklusion
- Religiöse Bildung für Nachhaltige Entwicklung
- Übersicht
- ReliLab Rhein-Main - Phasenvernetzung in der Lehrkräftebildung
- Pilotprojekt Praxissemester
- REMEMBER - Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht
- Leistungsbeurteilung
- Religiöse Bildung zukunftsfähig gestalten
- Konfessionell kooperativer Religionsunterricht
- Religionsdidaktik und Inklusion
- Religiöse Bildung für Nachhaltige Entwicklung
ReliLab Rhein-Main - Phasenvernetzung in der Lehrkräftebildung
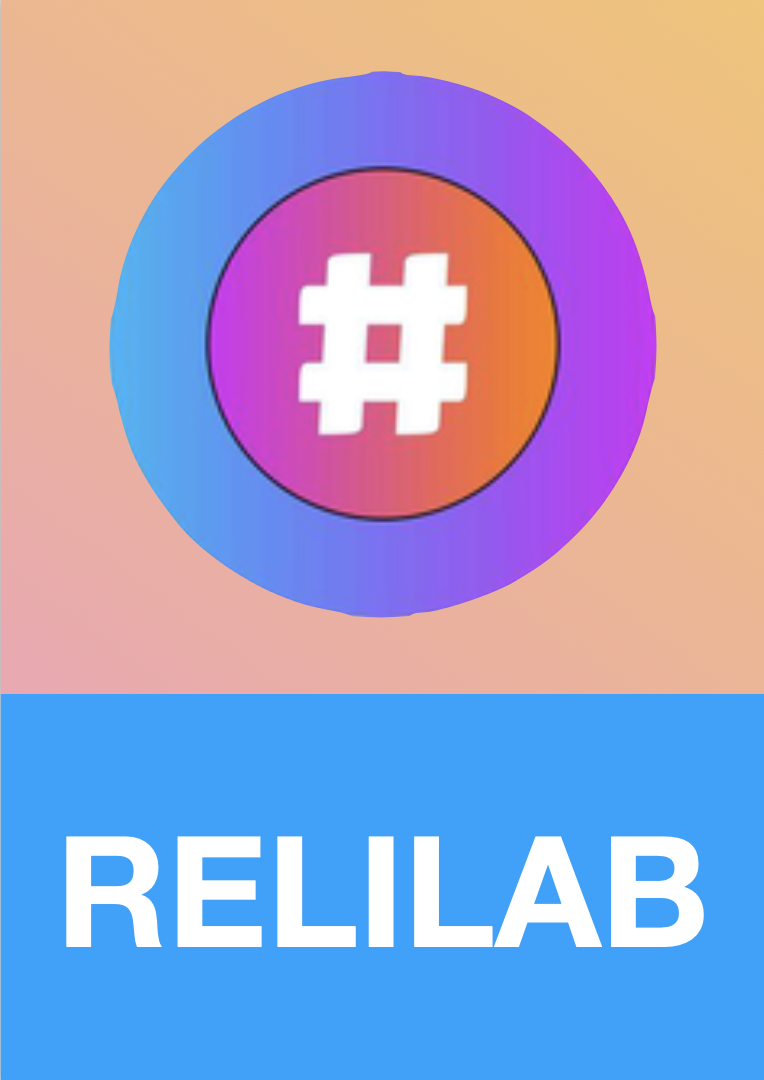
Die Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik beteiligt sich an dem international kooperativen, digital basierten Fortbildungs-Projekt für Religionslehrkräfte „relilab“. Am Standort Frankfurt setzt das Projekt besonders auf die Phasenvernetzung in der Lehrkräftebildung.
Das relilab ist ein im deutschsprachigen Raum entstandendes fachdidaktisches Labor und Netzwerk, in dem Lehrkräftebildung digital vernetzt und phasenübergreifend gedacht wird. Am Standort Rhein-Main versteht sich das relilab regional konzentriert als ein phasenübergreifendes Modell der Lehrkräftebildung. Studierende, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sowie Lehrkräfte an verschiedenen Schulformen beschreiten konfessionell-kooperativ persönliche Lernwege, gemeinsam im größeren Netzwerk und mit vielfältigen überregionalen Anknüpfungspunkten. So besteht ein Raum der Erprobung, Beobachtung und Entwicklung religiöser Bildung in einem Kontext der Digitalität: Neues kann entstehen, Altes transformiert werden. Das Team unterstützt Studierende und Lehrkräfte dabei, in diesem Labor einzeln und in kreativer, phasenübergreifender Kollaboration die eigenen Kompetenzen zu erweitern und selbst aktiv das Labor zu nutzen.
Kooperationen
- Hessische Lehrkräfteakademie
- Bistum Mainz
- PZ Hessen
Aktivitäten
- Hauptseminar „Relilab“ WS 2021/2022
- Hauptseminar „Relilab“ WS 2022/23
- Pirker, Viera; Gielians, Elena (19.03.2022), Präsentation zum Relilab am Thementag “Digitale Strategien in kirchlichen Handlungsfeldern” im Haus am Dom, Frankfurt am Main. Der Mitschnitt ist auf YouTube verfügbar
- Präsentation der Projekte aus dem Relilab Rheinmain (10.02.2022) https://relilab.org/rheinmain-projekte/
- Pirker, Viera (2022), Relilab Talk: Religion unterrichten in einer Kultur der Digitalität. https://relilab.org/religion-unterrichten-in-einer-kultur-der-digitalitaet/
- Höhl, Holger (2022), Relilab Talk: Filme erstellen – medium des Ausdrucks im Religionsunterricht. Online abrufbar unter: https://relilab.org/filme-erstellen-medium-des-ausdrucks-im-unterricht/
- Pirker, Viera (2022), Relilab Talk / Open Reli: Spiritualität in der Digitalität. Online abrufbar unter https://relilab.org/prof-dr-viera-pirker-spiritualitaet-in-der-digitalitaet/
Publikationen
- Die Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik verantwortet gemeinsam mit Jens Palkowitsch-Kühl und David Wakefield den theoriebezogenen Bereich im online-Lernlabor relilab.
- Pirker, Viera (2022), Die Evaluation digitaler Kompetenzen
- Ritz, Jessica (2022), Digitaler Adventskalender - der Countdown zu Weihnachten
- Höhl, Holger; Ritz, Jessica (2022), E-Portfolio und Mahara
- Höhl, Holger (2021), Schüler*innen als “Sinnfluenzer” – Filmerstellung im Lernprozess
- Pirker, Viera (2021), Menschsein im Zeitalter der Digitalität
Pilotprojekt Praxissemester
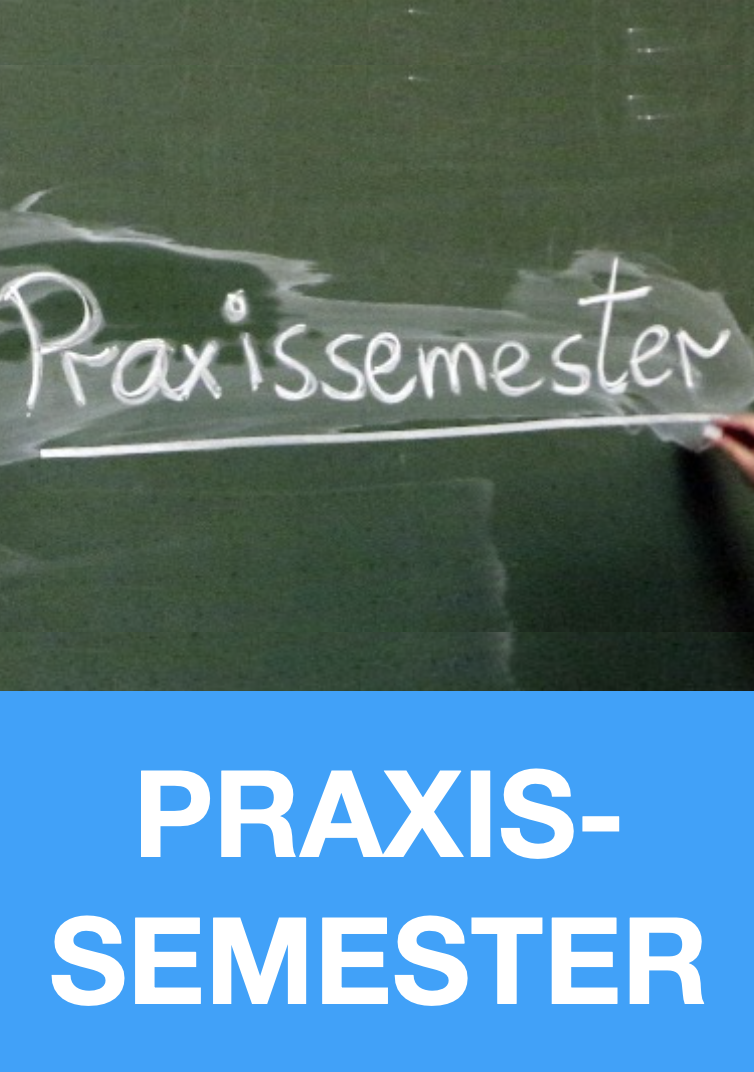
Seit dem Wintersemester 2015/2016 absolvieren die Studierenden des Lehramts an Gymnasien der Goethe-Universität Frankfurt a.M. ein Praxissemester. Im Unterschied zu den bisherigen Schulpraktika sollen die Studierenden bereits zu Beginn ihres Studiums (drittes bzw. viertes Semester) in einer intensiven Praxisphase von 15 Wochen das Berufsfeld „Lehrer*in“ kennen lernen und sich darin erproben. Neben der Herstellung des Berufsfeldbezugs werden gezielt Lerngelegenheiten zur Professionalisierung geschaffen sowie ein Selbstreflexionsprozess der Studierenden über die persönliche Eignung in Bezug auf das angestrebte Berufsfeld initiiert.
Die Begleitung und Beratung der Studierenden durch die Betreuer*innen an Universität und Schule sind in dieser Phase besonders wichtig. Hervorzuheben ist dabei, dass die universitären Begleitveranstaltungen in Tandems von Lehrpersonen der Fachdidaktik und Bildungswissenschaften erfolgen. Die inhaltliche Konzeptionierung dieser Begleitveranstaltungen wird an der Didaktischen Werkstatt - Arbeitsstelle für Diversität und Unterrichtsentwicklung der Goethe-Universität kontinuierlich begleitet und weiterentwickelt
Laufzeit
- 10/2015 - 12/2023
Förderung
- Land Hessen
Remember - Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht
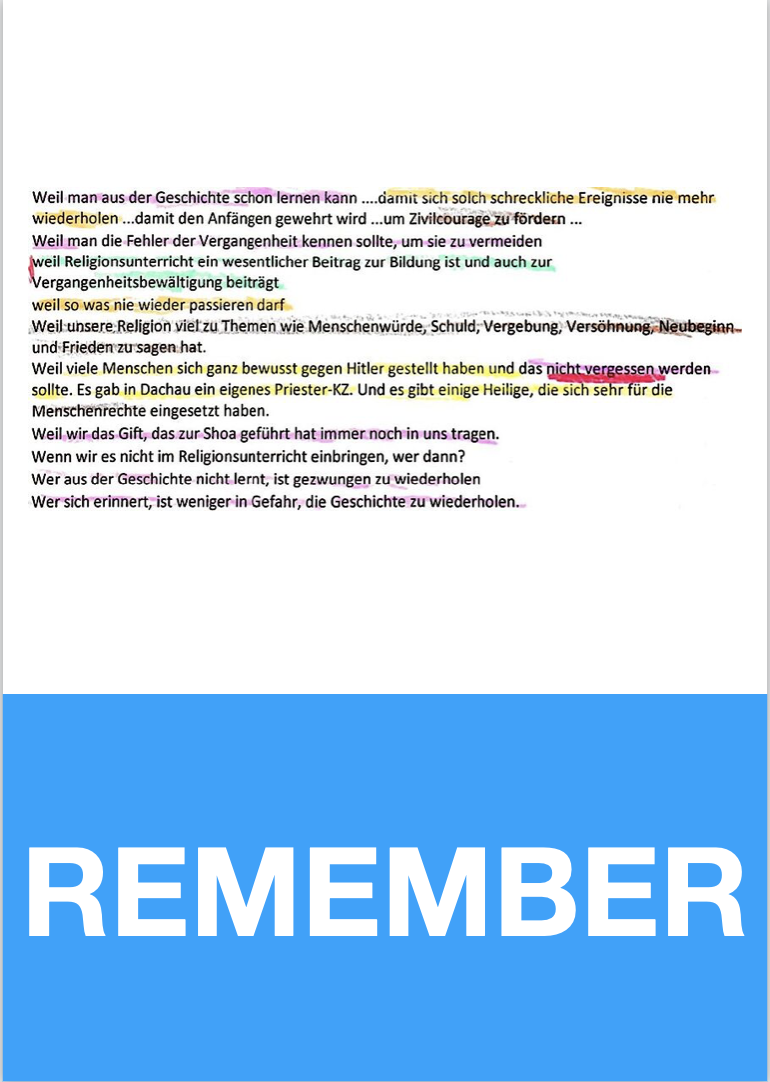
Ist ‚Erinnerung an den Holocaust / an die Schoah‘ für Religionslehrer*innen ein Thema im Unterricht? Wir wissen von vielen Lehrkräften, die sie das Thema „Erinnerung an den Holocaust / an die Schoah“ in Ihrem Religionsunterricht aufgreifen und auch in schulischen Aktivitäten und Projekten dazu engagiert sind. Eine 2016 durchgeführte Online-Befragung unter evangelischen und katholischen Religionslehrer*innen in Deutschland, Schweiz und Österreich ermöglicht den vertieften Einblick in die Aktivitäten im Kontext des Religionsunterrichts zu diesem Thema.
Kooperationen
- Forschungsgruppe REMEMBER: Universität Mainz – Unversität Tübingen – Universität Zürich – Universität Wien – Hochschule Benediktbeuren
- Stephan Altmeyer, Reinhold Boschki, Sonja Danner, Ralf Gaus, Burkhard Hennrich, Martin Jäggle, Andrea Lehner-Hartmann, Stefan Lemmermeier, Rebecca Nowack, Viera Pirker, Martin Rothgangel, Thomas Schlag, Wilhelm Schwendemann, Julia Spichal, Angelika Treibel, Anna Weber, Michèle Wenger
Publikationen
- Forschungsgruppe REMEMBER (Hg.) (2020): Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht. Empirische Einblicke und didaktische Impulse, Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 35).
- Forschungsgruppe REMEMBER (2020): Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht: Theoretische Ausgangspunkte, gesellschafts- und bildungspolitische Kontexte. In: Forschungsgruppe REMEMBER (Hg.): Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht. Empirische Einblicke und didaktische Impulse, Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 35), S. 19–30.
- Forschungsgruppe REMEMBER (2020): Religionspädagogische Konsequenzen und Impulse. In: Forschungsgruppe REMEMBER (Hg.): Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht. Empirische Einblicke und didaktische Impulse, Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 35), S. 209–243.
- Danner, Sonja; Jäggle, Martin; Lehner-Hartmann, Andrea; Pirker, Viera; Rothgangel, Martin (2020): "… kurz in Mauthausen …"? Holocaust und Erinnerungslernen im Religionsunterricht in Österreich. In: Forschungsgruppe REMEMBER (Hg.): Erinnerung an den Holocaust im Religionsunterricht. Empirische Einblicke und didaktische Impulse, Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 35), S. 79–102.
- Pirker, Viera; Habild, Constanze (2003): Auschwitz III Monowitz/Monowice: A Dialogue. In: Memory Work and Post Holocaust Identity. Confronting the Past as a Third Generation - Reflections on the 2002 International Summer Program on The Holocaust. St. Mary's College of Maryland, S. 50–52.
Leistungsbeurteilung

Im Zuge der Einführung der Neuen Oberstufe (NOST) in Österreich wurden kompetenzorientierte Modelle der Leistungsbeurteilung implementiert. Ein Kompetenzraster für das Unterrichtsfach Katholische Religion, das eine Arbeitsgruppe von Fachinspektor*innen entwickelt hat, wurde im Rahmen eines Begleitforschungsprojektes in vier Bundesländern (12 Schulklassen der Oberstufe AHS) erprobt und die Erfahrungen der Religionslehrer*innen wissenschaftlich evaluiert.
Die beteiligten Lehrkräfte erprobten und reflektierten die durch die Arbeitsgruppe erstellte Vorlage, sie diskutierten ihre Erfahrungen im Unterricht sowie ihre eigene Leistungsbeurteilungspraxis in mehreren leitfadengestützten Gruppengesprächen. Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte inhaltsanalytisch und in Ausschnitten sequenzanalytisch.
Die Forschungsergebnisse wurden zunächst in einen Projektbericht gebündelt (Abschluss November 2017), anschließend erfolgten für die Buchpublikation weitere Analyseschritte, die konsequent das fachdidaktisch spezifische Spannungsfeld Religion und Leistung im System Schule erschließen.
Laufzeit
- Sommer 2016 - Sommer 2019
Förderung
- Interdiözesanes Amt für Unterricht und Erziehung (IDA)
Kooperationen
- Dr. Viera Pirker (Wien); Dr. Maria Juen (Innsbruck)
Aktivitäten
- Lehrer*innenfortbildung: Religion und Leistung. Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung an AHS/BHS-Oberstufen (Viera Pirker) Institut für Fortbildung Religion, KPH Wien-Krems, 05.12.2018
- Präsentation des Projekts bei der Konferenz der Schulamtsleiter*innen der österreichischen Diözesen, Wien, 26.01.2018
- Posterpräsentation bei der Tagung der Sektion Didaktik (AKRK), Würzburg 18.-19.01.2018.
- Lehrer*innenfortbildung: Welche Note in Religion? Aktuelle Formen und Konzepte der Leistungsfeststellung (Dr. Maria Juen) Institut für religionspädagogische Bildung, Innsbruck, 21.11.2017.
- Posterpräsentation bei der Tagung des österreichischen Religionspädagogischen Forums, Salzburg, 15.-16.11.2017
- Präsentation des Projektberichts bei der ARGE Leistungsbeurteilungsverordnung, Wien, 13.11.2017.
Publikationen
- Pirker, Viera (2019): Weil du wertvoll bist: Anerkennung und Leistung, in: KatBl 144 H. 4, S. 260-265.
- Pirker, Viera; Juen, Maria (2018): Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung im Religionsunterricht der Oberstufe : Eine Evaluationsstudie, in: OERF 27 H.1, S. 226-244.
- Pirker, Viera; Juen, Maria (2018): Religion – (k)ein Fach wie jedes andere. Spannungsfelder und Perspektiven in der kompetenzorientierten Leistungsbeurteilung. Stuttgart: Kohlhammer (Religionspädagogik innovativ, 26). / Link zum Zusatzmaterial
- Juen, Maria (2018): Welche Note in Religion? Entscheiden im Kontext der Leistungsbeurteilung an Höheren Schulen, in: ÖKUM 30, H. 1, S. 12-13.
- Pirker, Viera & Juen, Maria, Abschlussbericht des Begleitforschungsprojekts "Erprobung einer kompetenzorientierten Leistungsbeurteilung Religion", November 2017 (intere Publikation).
- Poster: Pirker, Viera & Juen, Maria (2017): Religion: (k)ein Fach wie jedes andere.
Religiöse Bildung zukunftsfähig gestalten
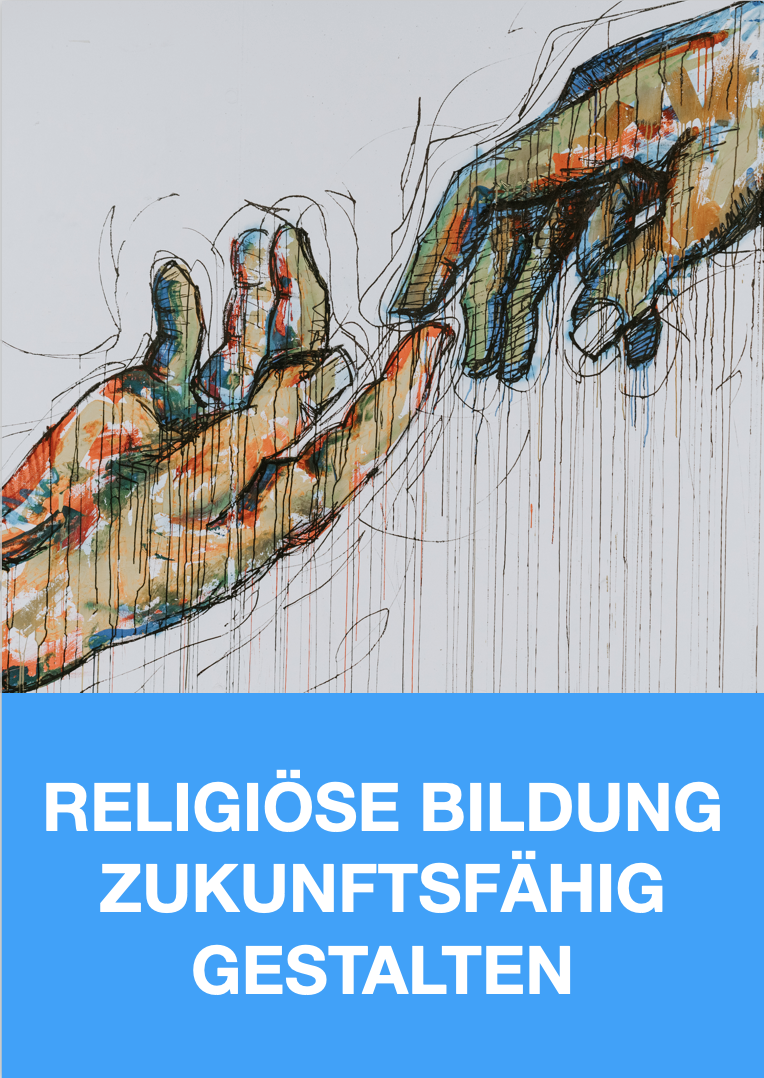
Ohne Vermittlung, Bildung und Formen der Weitergabe sind Religion und Theologie nicht zu denken. Pädagogischen Überlegungen und Entwicklungen kommt zu jeder Zeit höchste Relevanz zu, wenn ein System sich lebendig halten will. Religionspädagogik kann daher als ein altes Thema betrachtet werden, ist jedoch im universitären Kontext ein eher junges eigenständiges Fach. 2018 feierte der Fachbereich „Religionspädagogik und Katechetik“ der Universität Wien sein 50jähriges Bestehen. Dies wurde zum Anlass genommen, den Blick gezielt in die Zukunft zu richten: Welche Bedeutung kann religiöser Bildung angesichts gesellschaftlicher Veränderungen zukommen? Welche Themen lassen sich identifizieren, die intensiver aufgegriffen werden sollten? Vier gesamtgesellschaftliche Herausforderungen stellen sich exemplarisch: Demokratie und Gerechtigkeit, Digitaler Wandel und Medialität, Plurale Identitätskonzeptionen und die zunehmende Alterung der Gesellschaft.
Auf der Zukunftskonferenz wurden solche Aspekte im Gespräch mit Vertreter*innen anderer universitärer Disziplinen erörtert. Sie geben aus ihren jeweiligen Forschungsperspektiven heraus Impulse, die die Grenzen des religionspädagogischen Reflexionsraums weiten.
Aktivität
- Zur Zukunft religiöser Bildung. Interdisziplinäre Konferenz an der Universität Wien, 18.10.2018.
Publikationen
- Pirker, Viera (2023): Subjekt Mensch – mehr als ‚das Andere der künstlichen Intelligenz‘? Anthropologie als Grundfrage des Religionsunterrichts (Sekundarstufe I). In: Ilona Nord (Hg.): Religionsdidaktik: diversitätsorientiert und digital. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II: Cornelsen.
- Pirker, Viera; Mayrhofer, Florian (2023): Bild als Kritik: Image-Kommunikation in einem Unterrichtsprojekt. In: Susanne Reichl; Ute Smit (Hg.): Youth Mediatized Lifeworlds. Wien, im Erscheinen.
- Pirker, Viera (2023): Konfessionelle Identität in ihrer Relevanz für den kooperativen Religionsunterricht. In: Thomas Krobath; Andrea Taschl-Erber (Hg.): Miteinander?! Religionsunterricht in Kooperation, im Erscheinen.
- Fröhling, Christian; Mertesacker, Jakob; Pirker, Viera; Strunk, Theresia (Hg.): Wagnis Mensch werden. eine theologisch-praktische Anthropologie. Festschrift für Klaus Kießling zum 60. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2022.
- Lehner-Hartmann, Andrea; Pirker, Viera (Hg.) Religiöse Bildung - Perspektiven für die Zukunft. Interdisziplinäre Impulse für Religionspädagogik und Theologie, Ostfildern: Grünewald 2021.
- Lehner-Hartmann, Andrea; Novakovits, David; Peter, Karin; Pirker, Viera (2021): Konturen religiöser Bildung in der Gegenwart. Grundlegungen. In: Andrea Lehner-Hartmann und Viera Pirker (Hg.): Religiöse Bildung - Perspektiven für die Zukunft. Interdisziplinäre Impulse für Religionspädagogik und Theologie. Ostfildern: Grünewald, S. 145–173.
Konfessionell kooperativer Religionsunterricht

- Zur Zukunftsfähigkeit des Religionsunterrichts - Konfessionelle Kooperation auf dem Prüfstand
Veröffentlichungen
- Baumert, Britta und Carolin Teschmer, Konfessionell kooperativer Religionsunterricht. Eine Fachdidaktik. Stuttgart, 2024.
- Baumert, Britta und Caroline Teschmer, Prämissen zur konfessionell kooperativen Bildung. Ein Diskurs anlässlich der Einführung des CRU in Niedersachsen, in: Loccumer Pelikan (2023) 1, 41-45.
- Baumert, Britta und Caroline Teschmer, Konfessionell - kooperativ - pluralitätssensibel. Weichenstellungen einer Didaktik zum kokoRU 2.0, in: Tuna, Mehmet Hilmi / Juen, Marie (Hg.), Praxis für die Zukunft. Erfahrungen, Beispiele und Modelle kooperativen Religionsunterrichts. Stuttgart, 2021, 71-85.
Veröffentlichung des Tagungsbandes
- Im Laufe des Jahres 2024
Vorträge
| 2023 | Konzepte und Erkenntnisse für Schule und Lehrer:innenbildung. Einführender Vortrag im Rahmen der Tagung Zur Zukunftsfähigkeit des Religionsunterrichts – Konfessionelle Kooperation auf dem Prüfstand in Frankfurt am Main. |
| 2022 | Didaktik und Methodik des kokoRU. Gemeinsamer Vortrag und Workshop mit Caroline Teschmer im Rahmen der Weiterbildungsveranstaltung Evangelische Religion oder Katholische Religion an berufsbildenden Schulen. |
| 2021 | Konfessionell kooperativer Religionsunterricht 2.0. Wege zu einem zukunftsfähigen Religionsunterricht in evangelischer/katholischer Verantwortung. Gemeinsamer Vortrag mit Dr. Caroline Teschmer im Rahmen der Tagung: Praxis für die Zukunft. Universität Innsbruck, März 2021. |
| Der Religionsunterricht im Wandel. Organisationsformen und didaktische Perspektiven für konfessionelle Kooperation. Vortrag im Studienseminar Dortmund, Juni 2021. | |
| Konfessionell kooperativer Religionsunterricht 2.0 in Theorie und Praxis. Im Rahmen der Vokationstagung „Fit für den konfessionell kooperativen Religionsunterricht?!“ |

Forschungsschwerpunkt Inklusion
Projekte
- BRIDGES - Brücken bauen, Zusammenarbeit initiieren und gestalten (2019-2023) an der Universität Vechta
- Werkstatt Inklusion: "Gemeinsam statt einsam" Videoprojekt an der Universität Vechta
Veröffentlichungen
- Baumert, Britta u. a., Qualitätsmerkmale für einen digital-inklusiven Unterricht, in: Medien-Pädagogik, 20 (2023), 551–580.
- Baumert, Britta, Living Diversity. Schulpastoral als Chance zur Ausbildung einer inklusiven Schulkultur, in: Anzeiger für die Seelsorge (2021) 9, 14-19.
- Baumert, Britta/Willen, Mareike (Hg.), Die Werkstatt Inklusion. Qualitätsoffensive Lehrerbildung an der Universität Vechta, Waxmann, 2020.
- Baumert, Britta, ‚gemeinsam statt einsam'. gestaltpädagogisch Inklusion gestalten, in: Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge 97 (2020) 2, 45-47.
- Baumert, Britta/Willen, Mareike (Hg.), Zwischen Persönlichkeitsbildung und Leistungsentwicklung. Fachspezifische Zugänge zu inklusivem Unterricht im interdisziplinären Diskurs, Bad Heilbrunn, 2019.
Betreute Forschungsprojekte
- Eileen Küthe: Mose 4.0 - Konzeption und Evaluation einer digitalen Lernumgebung für den inklusiven Religionsunterricht an Grundschulen
- Christian Espelage: Schnittpunkte der Lernwege in der Lernprogression evozieren – Lerngegenstände und Lernumgebungen in einem inklusiven Religionsunterricht an Gymnasien

Religiöse Bildung für Nachhaltige Entwicklung (rBNE)
RBnE Ausgangspunkt für Überlegungen im Bereich rBNE sind Perspektiven auf die derzeitige ökologisch-soziale Situation, Überlegungen zum ethischen Prinzip Nachhaltigkeit sowie eine kritische Rezeption der säkularer BNE-Diskurse entlang der Würzburger Synode.
"Religiöse BNE fragt nach dem „Sinn-Grund“ des Lebens aller, auch der Zukünftigen und der Mitwelt. Religiöse BNE ist gerichtet auf die Relativierung eines spezifischen Absolutheitsanspruchs: den eines konsumorientierten, raum-, zeit- und zukunftslosen Lebensstils und der ihn stützenden Wirtschaftsweisen." (Bederna, K., 2020)
Der Forschungsschwerpunkt rBNE umfasst unter anderem ein universitätsübergreifende Seminar gemeinsam mit Studierenden und Dozenten der Johannes-Guttenberg-Universität Mainz und der TU Darmstatt statt. Ziel ist zum einen der Kompetenzerwerb im Bereich der religiösen Bildung für Nachhaltige Entwicklung und zum anderen die gemeinsame schulformspezifische Konzeption von Unterrichtsmaterialien für den Religionsunterricht sowie die Vernetzung mit Kooperationspartner*innen aus der Region, die für spätere Praxis in der Schule genutzt werden können.
Projekte
- Seminar: Religiöse Bildung für Nachhaltige Entwicklung (SS 2024)
Veröffentlichungen
- Lehr-Lern-Materialien für rBNE auf Open-Access Plattformen im Laufe des Jahres 2024
Forschungsschwerpunkt
MEDIENDIDAKTIK
Lehr@mt

Das Projekt Lehr@mt hat das Ziel die Medienkompetenz von Lehrerinnen und Lehrern in allen drei Phasen der hessischen Lehrerbildung zu fördern. Im Rahmen des Projektes werden mediendidaktische Materialien entwickelt, die in Schule, Fortbildung und Lehrerbildung, den drei Phasen der Lehrerbildung, verwendet werden. Zudem werden neue Formen der Unterrichtsgestaltung und Lehrerfortbildung erprobt, in denen multimediale und netzgestützte Materialien, Übungen und auch portfoliogestützte Selbstlernphasen zum Einsatz kommen.
Ziel der Zusammenarbeit von Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt und dem Amt für Lehrerbildung ist die bewusste und reflektierte Nutzung medialer Technologien im Kontext Schule.
Im Rahmen der Veranstaltung VINN (Ausbildungsveranstaltung Innovieren in Unterricht und Schule mit dem Schwerpunktbildungspolitisch relevanter Fragestellungen) werden phasenübergreifende Formate angeboten.
Kooperationen
- ABL
Ansprechpartner*innen
- Viera Pirker
- Holger Höhl (E-Mail: hoehl@em.uni-frankfurt.de)
M@PS - Medienkompetenz erweitern, Persönlichkeit stärken
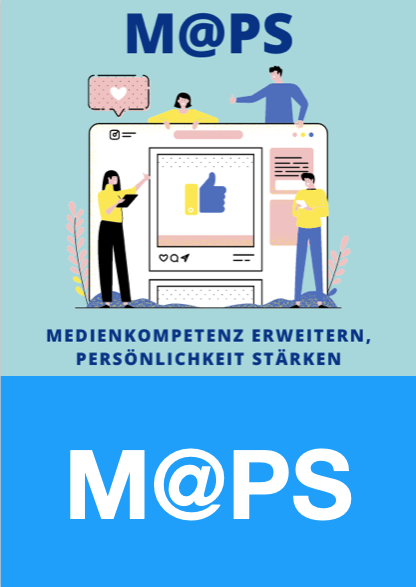
Im Rahmen der Bildungsinitiative „Löwenstark“, die Kinder und Jugendliche nach der Corona-Krise stärken soll, ist das hessische Kultusministerium in Kontakt mit Universitäten getreten um gemeinsame Projekte auszuarbeiten. Die Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik hat ein Konzept ausgearbeitet, das die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen sowie deren Persönlichkeitsentwicklung durch Workshops stärken soll. So entstand das Projekt „M@PS - Medienkompetenz erweitern, Persönlichkeit stärken“.
Die Ausgangslage
Der passive Medienkonsum von Schülerinnen und Schülern hat sich in der Zeit der Pandemie deutlich ausgeweitet. Aus Gedanken der Philosophie/Religion/Ethik heraus entwickelt, zielt M@Ps darauf ab, mit Schüler*innen der Sekundarstufe I ein Bewusstsein für ihren eigenen Medienkonsum zu entwickeln, und ihre eigene Persönlichkeit dabei zu stärken.
M@Ps legt dabei den Schwerpunkt auf das Erkennen und Stärken des eigenen Wohlbefindens in Hinblick auf mediale Handlungskompetenzen und eine kompetente Navigation des Selbst durch verschiedene Medienwelten.
Wir unterstützen Entwicklungsbedarfe wie:
- sozialpädagogische und persönliche Belange
- Reflexion und Entwicklung der eigenen Medienpraxis
- Stärkung der sozialen Kompetenz und der Selbstkompetenz
- Stärkung und Erweiterung der kreativ-adaptiven Medienkompetenz
- Entwicklung der medienbezogenen Kommunikation und Kreativität
- Entwicklung von Selbstständigkeit in medienbezogenem Handeln
Während der Laufzeit
Während der Laufzeit des Projekts wurden 3 Workshops entwickelt, die jeweils 6 Schulstunden umfassen, zu den Themenschwerpunkten:
- Wer bin ich? Wer will ich sein?
- Wer bin ich für andere Menschen?
- Was können wir bewirken?
Ausblick
Das Projekt soll auch langfristig Lehrkräfte in der Arbeit zu Medienkompetenz und Persönlichkeitsstärkung unterstützen. Deshalb werden alle Materialien als Open Educational Resources aufbereitet und über eine eigene Website kostenlos zur Verfügung gestellt unter: https://fr-agil.uni-frankfurt.de/maps/
Laufzeit
- August 2022 - Juli 2024
Förderung
- Hessisches Kultusministerium








