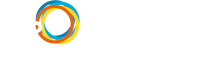Johanna Scheel - Zur Person
Koordinatorin des Goethe-Orientierungsstudiums Geistes- und Sozialwissenschaften 2018-2024
Dr. Johanna Scheel

Monografie und Herausgeberschaft
- Zusammen mit Rebecca Müller und Anselm Rau: Theologisches Wissen und die Kunst. Festschrift für Prof. Dr. Martin Büchsel, Berlin 2015.
- Das altniederländische Stifterbild. Emotionsstrategien des Sehens und der Selbsterkenntnis, Berlin 2014. (Promotionsschrift)
Mitchell Merback, in: Speculum 94,3 (2019), S. 894-896 (zum Volltext)
Peter Eschweiler, in: Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie, 47 (2014), 104-106.
Elena Filippi, in: Coincidentia 5,1 (2014), 197-203.
Ruth Slenczka, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 33 (2014).
Anna Simon, in: Journal für Kunstgeschichte 18,3 (2014), 226-231.
Aufsätze
- Portfolioarbeit als Tool in Orientierungsprozessen, Selbstevaluation und Studiengangsentwicklung, in: Handbuch Qualität in Studium, Lehre und Forschung, 2021
- Feeding Worms. The theological Paradox of the decaying Body and its Depictions in the context of Prayer and Devotion, in: Perkinson, Stephen/Turel, Noa (Hrsg.): Picturing Death 1200-1600, Leiden 2021
- Stifterbilder in Hessen: Aufgaben – Aufträge – Intentionen, in: Schütte, Ulrich/Locher, Hubert u.a.: Mittelalterliche Retabel in Hessen, Bd. I Bildsprache, Bildgestalt, Bildgebrauch, Petersberg 2019, S. 118-133.
- Erkenntnisprozesse: Nikolaus von Kues und die Kunst (der Interpretation), in: Cusanus-Jahrbuch 2018, S. 27-62. Dazu: Blog-Beitrag auf https://cusanus.hypotheses.org/
- Sich selbst sehen – der Betrachter in und vor dem Bild. Spiegel- und Stifterfiguren in Texten und Bildern des 15. Jahrhunderts. In: Koch, Elke/Schlie, Heike (Hrsg.): Orte der Imagination – Räume des Affekts. Die mediale Formierung des Sakralen, Berlin 2016.
- mit Kathrin Henrich/Christian Stein: Co-Teaching – ein innovatives Format für fachnahen Schlüsselkompetenzerwerb? Beispiel Geisteswissenschaften, in: Tagungsband - Teaching is touching the future, Bremen 2015.
- Meditation und Gebet - Affektsteuerung und Imagination durch Wort und Bild in der mittelalterlichen Devotionspraxis, in: Müller, Rebecca/Scheel, Johanna/Rau, Anselm: Theologisches Wissen und die Kunst. Festschrift für Prof. Dr. Martin Büchsel, Berlin 2015.
- Hartmut Böhme: Der anatomische Akt. Zur Bildgeschichte und Psychohistorie der frühneuzeitlichen Anatomie. Ein Buchessay. In: psychosozial, 132, 2/2013, S. 129-135.
- Die Emotionalität des emotionslosen Stifterbildes in der altniederländischen Malerei. In: Imago. Interdisziplinäres Jahrbuch für Psychoanalyse und Ästhetik, 1/2012, S. 105-124.
- Persönlichere Frömmigkeit im Spätmittelalter. Das altniederländische Stifterbild im Kontext von Selbst- und Gotteserkenntnis. In: Persönliche Frömmigkeit - Funktion und Bedeutung individueller Gotteskontakte im interdisziplinären Dialog [Sonderband: Hephaistos - Kritische Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Archäologie und angrenzender Gebiete, 28], Münster 2011, S. 185-201.
Rezensionen
- Annette Hojer und Christoph Krekel (Hgg.): Die Stuttgarter Apokalypse Tafeln, Dresden 2018, in: sehepunkte 19 (2019), Nr. 9 [15.09.2019], URL: http://www.sehepunkte.de/2019/09/32732.html
- David und Ulrike Ganz: Visionen der Endzeit. Die Apokalypse in der mittelalterlichen Buchkunst, Darmstadt 2016, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 36/2017, S. 399-400.
- Annelen Ottermann (Hrsg.): Das spätkarolingische Fragment eines illustrierten Apokalypse-Kommentars in der Mainzer Stadtbibliothek. Bilanz einer interdisziplinären Annäherung, Mainz 2014, in: H-Soz-Kult, 13.01.2016, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-25045>
- Hartmut Böhme: Der anatomische Akt. Zur Bildgeschichte und Psychohistorie der frühneuzeitlichen Anatomie. In: Imago, Interdisziplinäres Jahrbuch für Psychoanalyse und Ästhetik, 2/2013, S. 205-207.
In Vorbereitung/im Druck
- Feeding Worms. The theological paradox of the decaying body and its depictions in the context of prayer and devotion, in: Turel, Noah/Perkinson, Stephen: Picturing Death 1200-1600, Brill 2020 (peer reviewed).
- Personal Piety, in: Imitatio, eine Quellenanthologie (Arbeitstitel), 2021
- mit Anselm Rau: Hugo von St. Viktor – De modo orandi. Affekte als wesentliche Bestandteile und Voraussetzung für Gebet und Meditation. Mit einer dt. Übersetzung des Textes von De modo orandi, 2021.
Tagungen, Vorträge und Workshops
- Vortrag: Changing Memoria - Adapted Donor Portraits in Late Medieval Art, In der Sektion: Creative Memories: Shaping Identity in Medieval Culture, II; International Medieval Congress (IMC), 2.-6. Juli 2018, Leeds
- Vortrag: Reflective Meditation – Mirroring the Self in the Late Middle Ages. ARC Centre for the History of Emotions, The University of Melbourne Australia, 16.-17.03.2018
- Vortrag: Quod vides scribe in libro. Text-Bildverhältnis in Apokalypse-Kommentaren des Mittelalters: Alexander von Bremen. CDFI Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, 26.01.2018
- Vortrag: Psalmen - Imagination und Illumination. Workshop: Medialität und Praxis des Gebets in Mittelalter und Früher Neuzeit, 13.-14. September 2017, Dresden
- Vortrag: Illuminations as the 'Other' Text of the Apocalypse. In der Sektion: Beyond the Text? Other Ways of Reading. International Medieval Congress (IMC), 3.-7. Juli 2017, Leeds
- Vortrag: Feeding Worms? The decaying body in the context of prayer and devotion. In der Sektion: Eating (and Being Eaten) in the Afterlife and Otherworlds
- International Medieval Congress (IMC), 4.-8. Juli 2016, Leeds; ebd. Chair der Sektion: Devotional Instruction through Liturgy, Dream-Vision Poetry, and Philosophy
- Abendvortrag: Erkenntnisprozesse: Nikolaus von Kues und die Kunst, Institut für Cusanusforschung Trier, 06.11.2015
- Vortrag und Sektionsorganisation: Just Fear? Picturing the Apocalypse in Medieval Art. In der Sektion: Reform of/through Emotions and Emotional Systems in Medieval Art and Thought. International Medieval Congress (IMC), 6.-9. Juli 2015, Leeds
- Vortrag: Co-Teaching – ein innovatives Format für fachnahen Schlüsselkompetenz-erwerb? Beispiel Geisteswissenschaften. Teaching is touching the future, Bremen, September 2014
- Abendvortrag: The Donor Portrait in Early Netherlandish Painting. Emotional Strategies of Seeing and Self-knowledge, Vlaams Onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, 05. Dezember 2013, Brügge
- Vortrag und Workshoporganisation gemeinsam mit Anselm Rau: Hugo von St. Viktor – De modo orandi. Affekte als wesentliche Bestandteile und Voraussetzung für Gebet und Meditation, Workshop Historische Emotionsforschung, 09.02.2012, Frankfurt am Main.
- Vortrag: Seeing Oneself Judged: Donor Portraits in Last Judgements and Praying for the Hereafter, In der Sektion: Rules for Death and Dying in Images of Late Medieval Art. International Medieval Congress (IMC), 9.-12. Juli 2012, Leeds
- Workshop und Vortrag (zusammen mit PD Dr. Heike Schlie): Visionen und Visualisierungen im 15. Jahrhundert: Van Eyck, Cusanus and Alberti. Ordnungen des Sehens. Innovationsfelder der kunsthistorischen Niederlandeforschung. Internationale Konferenz des Arbeitskreises Niederländische Kunst- & Kulturgeschichte e.V. 30. September - 2. Oktober 2011, Frankfurt am Main
- Teilnahme an der Summer School: Made in the Netherlands. Arts from the 15th and the 16th Centuries. The Amsterdam-Maastricht Summer University 14.-25. August 2011, Amsterdam
- Vortrag: Das Bild als Spiegel – das Bild im Spiegel. Der Stifter in und vor der altniederländischen Malerei. Orte der Imagination – Räume des Affekts. Die mediale Formierung des Sakralen (1100-1600). 30. März - 01. April 2011, Göttingen
- Vortrag: Stifterdarstellungen im Spätmittelalter – Strategien der Gottes- und Selbsterkenntnis. ‚Persönliche Frömmigkeit'. Funktion und Bedeutung individueller Gotteskontakte im interdisziplinären Dialog. 25.-27. November 2010, Hamburg
- Tagungsorganisation und Vortrag: "Ad exercitandum devotionis affectum" – Fragen an das altniederländische Stifterbild. Gestaltete Gefühle. Strategie, Transformation und Rezeption von Emotionen im Mittelalter. 21.-23. Oktober 2010, Frankfurt am Main
- Vortrag: Immer wieder Endzeit? Die Apokalypse im Mittelalter. Historischer Kreis der Historisch-Archäologischen Gesellschaft Frankfurt am Main e.V. (HAG), 11. November 2008, Frankfurt am Main
Dissertation
Das Altniederländische Stifterbild. Emotionsstrategien des Sehens und der Selbsterkenntnis. Neue Frankfurter Forschungen zur Kunst 14, Gebr. Mann Verl. Berlin 2014.
Die Arbeit will eine Neubewertung des altniederländischen Stifterbildes vorschlagen. Der Schwerpunkt liegt auf der niederländischen Kunst und Kultur des 15. Jahrhunderts und verknüpfter Regionen. Ausgangspunkt sind dabei die kunsthistorischen Objekte und die phänomenologische Fragestellung nach den Funktionen des Stifterbildes für den einzelnen Gläubigen in einem religiösen Kontext. Um den kulturellen Horizont dieser Darstellungen in Hinblick auf ihre historisch-politischen sowie ideengeschichtlichen Implikationen zu untersuchen, wurde bewusst ein interdisziplinärer Ansatz gewählt: Neben Kunstwerken und schriftlichen Quellen verschiedener Genres und Sprachen sind ebenso Artefakte (wie bspw. den Alltagsgegenstand Spiegel) einbezogen worden. Außerdem ist eine Auseinandersetzung mit Theorien und Methoden der historischen und systematischen Emotionsforschung erfolgt. So ist ein neuer, kulturgeschichtlicher Blick auf das Verständnis spätmittelalterlicher Frömmigkeit und Subjektkonstitution entstanden. Ziel war es dabei auch anderen Disziplinen, die sich mit mittelalterlicher Geistesgeschichte befassen, Anregungen und Anknüpfungspunkte zu geben.

Eigene Organisation/Durchführung von Workshops und Weiterbildungen zu Fragen der Lehre
2023
Workshop "Mittsemestermüdigkeit? Modulare Reflexionsangebote für Studierende", im Rahmen der Workshopreihe "Lehrlabor", Lehrlabor, Zentrum Geisteswissenschaften GU
Seit 2020
Jährliche Lehreinsteigerwoche/Tutor*innenschulungswoche mit verschiedenen Workshops zu z.B. Tutorieller Lehre, Moderation, Vermittlung von akad. Schlüsselkompetenzen, Erstellung von Aufgaben, u.v.m.
SoSo 2020:
Verschiedene Workshops zum Thema virtueller Studieneinstieg:
- „Erstis ohne Campus - Ankommen und Kennenlernen virtuell. Austausch & Best Practice“, 10.09.2020 Barcamp GUvirtuell
- „Digitale (Selbst-)Orientierung zu Studienbeginn. Ankommen und Akklimatisation an der virtuellen Universität“, 21.09.2020 Digitaler Tag der RMU
- „Digitales Kennenlernen im GO Geistes- & Sozialwissenschaften“, 05.10.2020 interner Weiterbildungstag von PHILIS, JGU Mainz
- Workshop: „Der virtuelle Semesterstart. Austausch zu to do's und Tools in der virtuellen Lehre“, 21.10.2020, Lehrlabor, Zentrum Geisteswissenschaften GU
Februar 2015: Konzeption des 1. Akademischen Speeddatings zur Bildung interdisziplinärer Lehrkooperationen an der Goethe-Universität, halbtätige Veranstaltung in Kooperation mit dem Schreibzentrum. Die Veranstaltung selbst konnte leider nicht stattfinden.
SoSe 14 und WS 14/15: Organisation des Workshop-Formats „Lehrlabor“ für alle geisteswissenschaftlichen Fachbereiche der Goethe-Universität, 2-stündig, 3-4 Mal im Semester, im Rahmen der vertr. Koordination des Zentrums Geisteswissenschaften
Seit WS 13/14: fachspezifische Weiterbildungen für TutorInnen der Kunstgeschichte zu verschiedenen Themen, z.B. „aktivierende Methoden“, „Konflikte in der Lehre“, „Vortragskompetenz von Studierenden fördern“, 2-stündig, 2 Mal im Semester in Frankfurt; unregelmäßig in Marburg
SoSe 13 Großveranstaltungen in den Geisteswissenschaften, halbtägiger Workshop in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Kolleg Hochschuldidaktik der GU Frankfurt
Teilnahme an Weiterbildungen
2022 Projektmanagement mit Abschluss "Senior Project Manager", TÜV-zertifiziert
2021 Interne Weiterbildungen: Excel, Access, EvaSys, Moodle, "Verhandeln in agilen Zeiten" (Haufe Akademie), “Grundlagen für Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre” (Hochschulforum Digitalisierung)
2020 E-Learning-Zertifikat der Goethe-Universität, studiumdigitale
2020 Gut Beraten?! Interne Weiterbildung zum Thema Beratung im Rahmen der PO/PE
SoSe 17 Summer School „Verwaltung und Wissenschaftsmanagement. Überblick und Perspektiven für Einsteiger“ der Marburg University Research Academy (MARA)
WS 14/15 Erwerb des Zertifikats Hochschullehre der Goethe-Universität (21 ECTS)
2012 OLAT-Zertifikat

Forschungskonzept
Meine kunsthistorischen Forschungen verstehe ich als kulturwissenschaftlich. Ausgangspunkt sind stets die kunsthistorischen Objekte in ihren materiell-technischen und stilistischen Eigenheiten als Teil eines kulturellen Horizontes in Hinblick auf soziale und historisch-politische sowie ideen- und mentalitätsgeschichtliche Implikationen. Dabei beziehe ich randständige Werke und Artefakte, die außerhalb des klassischen kunsthistorischen Kanons liegen, ebenso mit ein, wie schriftliche Quellen verschiedener Genres und Sprachen. Dazu ist eine kritisch reflektierte Herangehensweise, ein interdisziplinärer Ansatz und der Einbezug historischer wie systematischer Arbeitsmethoden notwendig. Als wichtigen und an Bedeutung zunehmenden Aspekt meiner Forschung sehe ich den Einbezug von Tools der digitalen Kunstgeschichte bzw. Geisteswissenschaft, wie Datenbanken für Handschriften, schriftliche Quellen oder andere Objekte.
Mich beschäftigen vor allem phänomenologische Fragestellungen nach Funktionen und konkreten Kontexten von Werken sowie ihrer Rezeption durch die Zeitgenossen. In meinen bisherigen Forschungen konnte ich mich anhand von gewählten Schwerpunkten vor allem mit religiöser aber auch profaner Kunst im nordalpinen Raum vom Frühmittelalter bis zur Reformationszeit beschäftigen, in einem Spektrum, das vor allem Tafel- und Buchmalerei, jedoch auch Skulptur, Architektur und Werke angewandter Kunst wie Metall- oder Textilarbeiten umfasst. Mir ist zudem daran gelegen, auch anderen Disziplinen, die sich mit mittelalterlicher Geistesgeschichte befassen, Anregungen und Anknüpfungspunkte für eigene Forschungen zu geben. Auch in diesem Sinne verstehe ich mich als Teil des aktuellen Forschungsdiskurses zur Kunst und Kultur des Mittelalters und schätze den Austausch mit WissenschaftlerInnen im In- und Ausland sehr; dies geschieht zum Teil bilateral bzw. auf dem jährlichen IMC in Leeds, in einem freien Netzwerk zu Praxis und Medialität des Gebets sowie im Arbeitskreis niederländische Kunst- und Kulturgeschichte.

Lehrkonzept
Lehre bedeutet für mich, die Studierenden zu einem zielgerichteten, methodisch reflektierten und diskursiven Umgang mit der Fachmaterie anzuleiten, ihnen fachliches Wissen zu vermitteln und eigenen Wissenserwerb zu katalysieren, sowie sie mit akademischen Schlüsselkompetenzen und wissenschaftlichen Arbeitsmethoden vertraut zu machen. Dabei strebe ich eine möglichst gegenstandsnahe und praxisorientierte Methodik der Vermittlung an.
Meine Rolle als Dozentin definiere ich daher über diejenige als Wissensvermittlerin hinaus als die einer Gesprächspartnerin und Moderatorin innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses mit und zwischen den Studierenden, sowie als Beraterin für fachliche und methodische Fragen. Besonders wichtig ist es mir, die Lernmotivation der Studierenden zu fördern, ihren Enthusiasmus gegenüber fachlichen Inhalten zu wecken, sie auf ihr eigenes Vermögen/Potential bei der Teilnahme an einem wissenschaftlichen Diskurs – sei es in Form eines Seminarbeitrags oder einer schriftlichen Hausarbeit – hinzuweisen.
Die Schaffung einer kooperativen und partizipativen Lernatmosphäre durch den Einsatz von Gruppen- und Partnerarbeit, sowie ein aktivierender Einbezug der Studierenden bei Frontalkonstellationen ist dazu Voraussetzung. Innerhalb der Veranstaltungen wird großer Wert auf Kontakt unter den Studierenden gelegt, sowie ebenso auf den Kontakt zwischen mir und den Studierenden; die Studierenden werden neben der Anleitung zum eigenständigen Arbeiten auch außerhalb des Veranstaltungskontextes zur Zusammenarbeit ermutigt. Unterstützend und beratend stehe ich als Lehrperson diesen Prozessen zur Seite, wobei individuelle Lernstile ebenso innerhalb der Veranstaltungen berücksichtigt werden, bspw. durch den Einsatz von alternativen Lern-und Prüfungsmethoden (Portfolioarbeit, simultane Referate mit Posterpräsentation, Blogs, Gruppenarbeiten mit verteilten Verantwortlichkeiten). Diese Methoden werden auf die Fachinhalte ebenso wie auf die Studienphase der Studierenden abgestimmt eingesetzt und fördern die Selbstwahrnehmung der Studierenden als Fachexperten und Verantwortliche für bestimmte Veranstaltungsabschnitte; dadurch, ebenso wie durch verschiedene Gruppenarbeits-, Referats- und Präsentationsformen werden Vorbehalte und Hemmungen der Studierenden gegenüber jenen fachlichen und diesen methodischen Schlüsselkompetenzen (reflektierter Umgang mit den Tools der Digital Humanities, Präsentieren, Teamarbeit, Arbeitsorganisation, Selbst- und Zeitmanagement etc.) abgebaut. Ebenso findet dadurch eine Sensibilisierung für die Wichtigkeit selbstverantwortlichen Lernens statt.
Dabei wird von meiner Seite zudem großer Wert auf einen möglichst hohen Praxisbezug in den Veranstaltungen gelegt (Besuch von Museen, Kirchen und Bauten im Stadtraum, Bibliotheken und Archiven etc. um Kunstwerke im Original zu analysieren), als auch auf die Aneignung moderner Hilfsmittel und Methoden für die kunsthistorische Forschung (Internet-Datenbanken, Blogs, neue Präsentationsmethoden, etc.). Es ist für mich wichtig, meine eigenen Lehr/Lernmethoden zu reflektieren und auf die Wirksamkeit in Bezug auf die zu vermittelnden Fachinhalte zu überprüfen.
Aus hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahmen und dem Austausch mit (Fach-)KollegInnen ist es mir möglich, Anregungen für die eigene Lehre zu ziehen. Erkenntnisse und Bedarfe werden aus Lehrevaluationen erhoben und in folgende Veranstaltungen integriert. Das Themenspektrum meiner Veranstaltungen bewegt sich innerhalb der Kunstgeschichte und legt vor allem Wert auf eine intensive Heranführung der Studierenden an ikonografische, stilistische und methodische Aspekte der Werke und ihres Kontextes.
Meine eigene Forschung ist geprägt durch dezidiert interdisziplinäre, kulturwissenschaftliche und ideengeschichtliche Herangehensweisen, die Fragen nach Kontext, Funktion sowie nach kunsttechnischen Aspekten stehen bei mir im Fokus. In der Lehre ist es mir ein Anliegen, diese Interessen mit einzubringen, zu verfolgen und den Studierenden als wichtige Sichtweisen kunsthistorischen Arbeitens zu vermitteln.
Lehrerfahrung
Seit 2020: didaktische Gesamtverantwortung für sowie Lehre in verschiedenen Formaten des Curriculums des Goethe-Orientierungsstudiums - u.a. Moderation und Durchführung versch. Veranstaltungen, Ringvorlesungen, Durchführung von Workshops, Betreuung von Portfolio-Arbeiten etc.
Seminar: Praktisches Bildwissen, WS21/22 (2 SWS, versch. ECTS) [Mit Peter Gorzolla, Historisches Seminar]
Seminar: Biblische Texte und Motive zwischen Theologie und Kunstgeschichte, SoSe 19 (2 SWS, versch. ECTS) [Mit Malte Dücker, Fb 06]
Übung: mittelalter/film/bilder (2 SWS, versch. ECTS) [Mit Peter Gorzolla, Historisches Seminar]
Hauptseminar mit Exkursion: Altniederländische Malerei, SoSe 18 (2 SWS, 8 ECTS)
Übung: Schätze und Objekte im Mittelalter, SoSe 18 (2 SWS, versch. ECTS)
Projektseminar: Text und Bild im Mittelalter, WS 17/18 (2 SWS, versch. ECTS)
Oberseminar/Hauptseminar: Kunst um 1400, SoSe 17 (2 SWS, versch. ECTS)
Übung/Proseminar: Sakralarchitektur im Mittelalter, SoSe 15 u. SoSe 17 (2 SWS, versch. ECTS)
Projektseminar und Posterausstellung: Himmel, Hölle, Fegefeuer in mittelalterlichen Kunst und Vorstellungswelt, WS 16/17 (2 SWS, versch. ECTS)
Übung: Hieronymus Bosch, WS 16/17 (2 SWS, 6 ECTS)
Proseminar: Performativität in Kunst und Kultur des Mittelalters, SoSe 16 (2 SWS, 7 ECTS)
Übung: Theorien und Methoden der Kunstgeschichte, SoSe 16 (2 SWS, 6 ECTS)
Übung: Christliche Ikonografie mittelalterlicher Kunst, WS 15/16 (2 SWS, 6 ECTS)
Projektseminar und Posterausstellung: Buchmalerei im Mittelalter, WS 15/16 (2 SWS)
Oberseminar/Hauptseminar: Persönliche Frömmigkeit im Mittelalter, SoSe 15 (2-3 SWS, versch. ECTS)
Proseminar mit begleitender Exkursion „Kunst im Mittelalter – Gattungen, Techniken, Orte, Themen, Personen“, WS 14/15 (2 SWS, 7 ECTS); 3 tägige Exkursion
Proseminar „Apokalypse und Weltgericht in mittelalterlicher Kunst und Vorstellungswelt“, SoSe 14 (2 SWS, 7 ECTS)
Propädeutikum „Wissenschaftliche Arbeitsweisen und Methoden der Kunstgeschichte“, WS 12/13 – WS 14/15 (jeweils 2 SWS, 9 ECTS)
Proseminar (in Lehrkollaboration mit FB 06 der Goethe-Universität Evangelische Theologie) „Die Bibel in Wort und Bild“, WS 13/14 (2 SWS, 7 ECTS)
Proseminar „Immer wieder Endzeit? Darstellungen der Apokalypse im Mittelalter“, SoSe 10 (2 SWS)
Organisation/Durchführung von Workshops und Weiterbildungen zu Fragen der Lehre
Februar 2015 Konzeption des 1. Akademischen Speeddatings zur Bildung interdisziplinärer Lehrkooperationen an der Goethe-Universität, halbtätige Veranstaltung in Kooperation mit dem Schreibzentrum. Die Veranstaltung selbst konnte leider nicht stattfinden.
SoSe 14 und WS 14/15 Organisation des Workshop-Formats „Lehrlabor“ für alle geisteswissenschaftlichen Fachbereiche der Goethe-Universität, 2-stündig, 3-4 Mal im Semester, im Rahmen der vertr. Koordination des Zentrums Geisteswissenschaften
Seit WS 13/14 fachspezifische Weiterbildungen für TutorInnen der Kunstgeschichte zu verschiedenen Themen, z.B. „aktivierende Methoden“, „Konflikte in der Lehre“, „Vortragskompetenz von Studierenden fördern“, 2-stündig, 2 Mal im Semester in Frankfurt; unregelmäßig in Marburg
SoSe 13 Großveranstaltungen in den Geisteswissenschaften, halbtägiger Workshop in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Kolleg Hochschuldidaktik der GU Frankfurt
Teilnahme an Weiterbildungen
SoSe 17 Summer School „Verwaltung und Wissenschaftsmanagement. Überblick und Perspektiven für Einsteiger“ der Marburg University Research Academy (MARA)
WS 14/15 Erwerb des Zertifikats Hochschullehre der Goethe-Universität (21 ECTS)

Akademischer Lebenslauf
- Seit 09/2018 Wissenschaftliche Koordination des Projekts „Orientierungsstudium Geistes- und Sozialwissenschaften“
- 2015-2018 Wissenschaftliche Assistenz, Kunstgeschichtliches Institut, Philipps-Universität Marburg
- 2014-15 vertretungsweise Koordination des Zentrums Geisteswissenschaften im BMBF-Programm "Starker Start"
- 2012-2015 Mitarbeiterin am BMBF-Programm "Starker Start ins Studium", Kunstgeschichtliches Institut der Goethe-Universität Frankfurt
- 2013 Promotion "Das altniederländische Stifterbild. Emotionsstrategien des Sehens und der Selbsterkenntnis", ausgezeichnet mit dem Benvenuto Cellini-Preis durch die Benvenuto Cellini-Gesellschaft
- 2010 Assistenzvertretung am Lehrstuhl von Prof. M. Büchsel, Kunstgeschichtliches Institut, Goethe-Universität Frankfurt
- 2007-2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstgeschichtlichen Institut, Goethe-Universität: DGF-Projekt "Fühlen und Erkennen. Kognitive Funktionen der Darstellung von Emotionen in der mittelalterlichen Kunst"
- 2001-2007 Studium der Fächer Kunstgeschichte sowie Mittlere und Neuere Geschichte, Goethe-Universität Frankfurt

Monografie und Herausgeberschaft
- Zusammen mit Rebecca Müller und Anselm Rau: Theologisches Wissen und die Kunst. Festschrift für Prof. Dr. Martin Büchsel, Berlin 2015.
- Das altniederländische Stifterbild. Emotionsstrategien des Sehens und der Selbsterkenntnis, Berlin 2014. (Promotionsschrift)
Mitchell Merback, in: Speculum 94,3 (2019), S. 894-896 (zum Volltext)
Peter Eschweiler, in: Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie, 47 (2014), 104-106.
Elena Filippi, in: Coincidentia 5,1 (2014), 197-203.
Ruth Slenczka, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 33 (2014).
Anna Simon, in: Journal für Kunstgeschichte 18,3 (2014), 226-231.
Aufsätze
- Portfolioarbeit als Tool in Orientierungsprozessen, Selbstevaluation und Studiengangsentwicklung, in: Handbuch Qualität in Studium, Lehre und Forschung, 2021
- Feeding Worms. The theological Paradox of the decaying Body and its Depictions in the context of Prayer and Devotion, in: Perkinson, Stephen/Turel, Noa (Hrsg.): Picturing Death 1200-1600, Leiden 2021
- Stifterbilder in Hessen: Aufgaben – Aufträge – Intentionen, in: Schütte, Ulrich/Locher, Hubert u.a.: Mittelalterliche Retabel in Hessen, Bd. I Bildsprache, Bildgestalt, Bildgebrauch, Petersberg 2019, S. 118-133.
- Erkenntnisprozesse: Nikolaus von Kues und die Kunst (der Interpretation), in: Cusanus-Jahrbuch 2018, S. 27-62. Dazu: Blog-Beitrag auf https://cusanus.hypotheses.org/
- Sich selbst sehen – der Betrachter in und vor dem Bild. Spiegel- und Stifterfiguren in Texten und Bildern des 15. Jahrhunderts. In: Koch, Elke/Schlie, Heike (Hrsg.): Orte der Imagination – Räume des Affekts. Die mediale Formierung des Sakralen, Berlin 2016.
- mit Kathrin Henrich/Christian Stein: Co-Teaching – ein innovatives Format für fachnahen Schlüsselkompetenzerwerb? Beispiel Geisteswissenschaften, in: Tagungsband - Teaching is touching the future, Bremen 2015.
- Meditation und Gebet - Affektsteuerung und Imagination durch Wort und Bild in der mittelalterlichen Devotionspraxis, in: Müller, Rebecca/Scheel, Johanna/Rau, Anselm: Theologisches Wissen und die Kunst. Festschrift für Prof. Dr. Martin Büchsel, Berlin 2015.
- Hartmut Böhme: Der anatomische Akt. Zur Bildgeschichte und Psychohistorie der frühneuzeitlichen Anatomie. Ein Buchessay. In: psychosozial, 132, 2/2013, S. 129-135.
- Die Emotionalität des emotionslosen Stifterbildes in der altniederländischen Malerei. In: Imago. Interdisziplinäres Jahrbuch für Psychoanalyse und Ästhetik, 1/2012, S. 105-124.
- Persönlichere Frömmigkeit im Spätmittelalter. Das altniederländische Stifterbild im Kontext von Selbst- und Gotteserkenntnis. In: Persönliche Frömmigkeit - Funktion und Bedeutung individueller Gotteskontakte im interdisziplinären Dialog [Sonderband: Hephaistos - Kritische Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Archäologie und angrenzender Gebiete, 28], Münster 2011, S. 185-201.
Rezensionen
- Annette Hojer und Christoph Krekel (Hgg.): Die Stuttgarter Apokalypse Tafeln, Dresden 2018, in: sehepunkte 19 (2019), Nr. 9 [15.09.2019], URL: http://www.sehepunkte.de/2019/09/32732.html
- David und Ulrike Ganz: Visionen der Endzeit. Die Apokalypse in der mittelalterlichen Buchkunst, Darmstadt 2016, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 36/2017, S. 399-400.
- Annelen Ottermann (Hrsg.): Das spätkarolingische Fragment eines illustrierten Apokalypse-Kommentars in der Mainzer Stadtbibliothek. Bilanz einer interdisziplinären Annäherung, Mainz 2014, in: H-Soz-Kult, 13.01.2016, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-25045>
- Hartmut Böhme: Der anatomische Akt. Zur Bildgeschichte und Psychohistorie der frühneuzeitlichen Anatomie. In: Imago, Interdisziplinäres Jahrbuch für Psychoanalyse und Ästhetik, 2/2013, S. 205-207.
In Vorbereitung/im Druck
- Feeding Worms. The theological paradox of the decaying body and its depictions in the context of prayer and devotion, in: Turel, Noah/Perkinson, Stephen: Picturing Death 1200-1600, Brill 2020 (peer reviewed).
- Personal Piety, in: Imitatio, eine Quellenanthologie (Arbeitstitel), 2021
- mit Anselm Rau: Hugo von St. Viktor – De modo orandi. Affekte als wesentliche Bestandteile und Voraussetzung für Gebet und Meditation. Mit einer dt. Übersetzung des Textes von De modo orandi, 2021.
Tagungen, Vorträge und Workshops
- Vortrag: Changing Memoria - Adapted Donor Portraits in Late Medieval Art, In der Sektion: Creative Memories: Shaping Identity in Medieval Culture, II; International Medieval Congress (IMC), 2.-6. Juli 2018, Leeds
- Vortrag: Reflective Meditation – Mirroring the Self in the Late Middle Ages. ARC Centre for the History of Emotions, The University of Melbourne Australia, 16.-17.03.2018
- Vortrag: Quod vides scribe in libro. Text-Bildverhältnis in Apokalypse-Kommentaren des Mittelalters: Alexander von Bremen. CDFI Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, 26.01.2018
- Vortrag: Psalmen - Imagination und Illumination. Workshop: Medialität und Praxis des Gebets in Mittelalter und Früher Neuzeit, 13.-14. September 2017, Dresden
- Vortrag: Illuminations as the 'Other' Text of the Apocalypse. In der Sektion: Beyond the Text? Other Ways of Reading. International Medieval Congress (IMC), 3.-7. Juli 2017, Leeds
- Vortrag: Feeding Worms? The decaying body in the context of prayer and devotion. In der Sektion: Eating (and Being Eaten) in the Afterlife and Otherworlds
- International Medieval Congress (IMC), 4.-8. Juli 2016, Leeds; ebd. Chair der Sektion: Devotional Instruction through Liturgy, Dream-Vision Poetry, and Philosophy
- Abendvortrag: Erkenntnisprozesse: Nikolaus von Kues und die Kunst, Institut für Cusanusforschung Trier, 06.11.2015
- Vortrag und Sektionsorganisation: Just Fear? Picturing the Apocalypse in Medieval Art. In der Sektion: Reform of/through Emotions and Emotional Systems in Medieval Art and Thought. International Medieval Congress (IMC), 6.-9. Juli 2015, Leeds
- Vortrag: Co-Teaching – ein innovatives Format für fachnahen Schlüsselkompetenz-erwerb? Beispiel Geisteswissenschaften. Teaching is touching the future, Bremen, September 2014
- Abendvortrag: The Donor Portrait in Early Netherlandish Painting. Emotional Strategies of Seeing and Self-knowledge, Vlaams Onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, 05. Dezember 2013, Brügge
- Vortrag und Workshoporganisation gemeinsam mit Anselm Rau: Hugo von St. Viktor – De modo orandi. Affekte als wesentliche Bestandteile und Voraussetzung für Gebet und Meditation, Workshop Historische Emotionsforschung, 09.02.2012, Frankfurt am Main.
- Vortrag: Seeing Oneself Judged: Donor Portraits in Last Judgements and Praying for the Hereafter, In der Sektion: Rules for Death and Dying in Images of Late Medieval Art. International Medieval Congress (IMC), 9.-12. Juli 2012, Leeds
- Workshop und Vortrag (zusammen mit PD Dr. Heike Schlie): Visionen und Visualisierungen im 15. Jahrhundert: Van Eyck, Cusanus and Alberti. Ordnungen des Sehens. Innovationsfelder der kunsthistorischen Niederlandeforschung. Internationale Konferenz des Arbeitskreises Niederländische Kunst- & Kulturgeschichte e.V. 30. September - 2. Oktober 2011, Frankfurt am Main
- Teilnahme an der Summer School: Made in the Netherlands. Arts from the 15th and the 16th Centuries. The Amsterdam-Maastricht Summer University 14.-25. August 2011, Amsterdam
- Vortrag: Das Bild als Spiegel – das Bild im Spiegel. Der Stifter in und vor der altniederländischen Malerei. Orte der Imagination – Räume des Affekts. Die mediale Formierung des Sakralen (1100-1600). 30. März - 01. April 2011, Göttingen
- Vortrag: Stifterdarstellungen im Spätmittelalter – Strategien der Gottes- und Selbsterkenntnis. ‚Persönliche Frömmigkeit'. Funktion und Bedeutung individueller Gotteskontakte im interdisziplinären Dialog. 25.-27. November 2010, Hamburg
- Tagungsorganisation und Vortrag: "Ad exercitandum devotionis affectum" – Fragen an das altniederländische Stifterbild. Gestaltete Gefühle. Strategie, Transformation und Rezeption von Emotionen im Mittelalter. 21.-23. Oktober 2010, Frankfurt am Main
- Vortrag: Immer wieder Endzeit? Die Apokalypse im Mittelalter. Historischer Kreis der Historisch-Archäologischen Gesellschaft Frankfurt am Main e.V. (HAG), 11. November 2008, Frankfurt am Main
Dissertation
Das Altniederländische Stifterbild. Emotionsstrategien des Sehens und der Selbsterkenntnis. Neue Frankfurter Forschungen zur Kunst 14, Gebr. Mann Verl. Berlin 2014.
Die Arbeit will eine Neubewertung des altniederländischen Stifterbildes vorschlagen. Der Schwerpunkt liegt auf der niederländischen Kunst und Kultur des 15. Jahrhunderts und verknüpfter Regionen. Ausgangspunkt sind dabei die kunsthistorischen Objekte und die phänomenologische Fragestellung nach den Funktionen des Stifterbildes für den einzelnen Gläubigen in einem religiösen Kontext. Um den kulturellen Horizont dieser Darstellungen in Hinblick auf ihre historisch-politischen sowie ideengeschichtlichen Implikationen zu untersuchen, wurde bewusst ein interdisziplinärer Ansatz gewählt: Neben Kunstwerken und schriftlichen Quellen verschiedener Genres und Sprachen sind ebenso Artefakte (wie bspw. den Alltagsgegenstand Spiegel) einbezogen worden. Außerdem ist eine Auseinandersetzung mit Theorien und Methoden der historischen und systematischen Emotionsforschung erfolgt. So ist ein neuer, kulturgeschichtlicher Blick auf das Verständnis spätmittelalterlicher Frömmigkeit und Subjektkonstitution entstanden. Ziel war es dabei auch anderen Disziplinen, die sich mit mittelalterlicher Geistesgeschichte befassen, Anregungen und Anknüpfungspunkte zu geben.

Eigene Organisation/Durchführung von Workshops und Weiterbildungen zu Fragen der Lehre
2023
Workshop "Mittsemestermüdigkeit? Modulare Reflexionsangebote für Studierende", im Rahmen der Workshopreihe "Lehrlabor", Lehrlabor, Zentrum Geisteswissenschaften GU
Seit 2020
Jährliche Lehreinsteigerwoche/Tutor*innenschulungswoche mit verschiedenen Workshops zu z.B. Tutorieller Lehre, Moderation, Vermittlung von akad. Schlüsselkompetenzen, Erstellung von Aufgaben, u.v.m.
SoSo 2020:
Verschiedene Workshops zum Thema virtueller Studieneinstieg:
- „Erstis ohne Campus - Ankommen und Kennenlernen virtuell. Austausch & Best Practice“, 10.09.2020 Barcamp GUvirtuell
- „Digitale (Selbst-)Orientierung zu Studienbeginn. Ankommen und Akklimatisation an der virtuellen Universität“, 21.09.2020 Digitaler Tag der RMU
- „Digitales Kennenlernen im GO Geistes- & Sozialwissenschaften“, 05.10.2020 interner Weiterbildungstag von PHILIS, JGU Mainz
- Workshop: „Der virtuelle Semesterstart. Austausch zu to do's und Tools in der virtuellen Lehre“, 21.10.2020, Lehrlabor, Zentrum Geisteswissenschaften GU
Februar 2015: Konzeption des 1. Akademischen Speeddatings zur Bildung interdisziplinärer Lehrkooperationen an der Goethe-Universität, halbtätige Veranstaltung in Kooperation mit dem Schreibzentrum. Die Veranstaltung selbst konnte leider nicht stattfinden.
SoSe 14 und WS 14/15: Organisation des Workshop-Formats „Lehrlabor“ für alle geisteswissenschaftlichen Fachbereiche der Goethe-Universität, 2-stündig, 3-4 Mal im Semester, im Rahmen der vertr. Koordination des Zentrums Geisteswissenschaften
Seit WS 13/14: fachspezifische Weiterbildungen für TutorInnen der Kunstgeschichte zu verschiedenen Themen, z.B. „aktivierende Methoden“, „Konflikte in der Lehre“, „Vortragskompetenz von Studierenden fördern“, 2-stündig, 2 Mal im Semester in Frankfurt; unregelmäßig in Marburg
SoSe 13 Großveranstaltungen in den Geisteswissenschaften, halbtägiger Workshop in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Kolleg Hochschuldidaktik der GU Frankfurt
Teilnahme an Weiterbildungen
2022 Projektmanagement mit Abschluss "Senior Project Manager", TÜV-zertifiziert
2021 Interne Weiterbildungen: Excel, Access, EvaSys, Moodle, "Verhandeln in agilen Zeiten" (Haufe Akademie), “Grundlagen für Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre” (Hochschulforum Digitalisierung)
2020 E-Learning-Zertifikat der Goethe-Universität, studiumdigitale
2020 Gut Beraten?! Interne Weiterbildung zum Thema Beratung im Rahmen der PO/PE
SoSe 17 Summer School „Verwaltung und Wissenschaftsmanagement. Überblick und Perspektiven für Einsteiger“ der Marburg University Research Academy (MARA)
WS 14/15 Erwerb des Zertifikats Hochschullehre der Goethe-Universität (21 ECTS)
2012 OLAT-Zertifikat

Forschungskonzept
Meine kunsthistorischen Forschungen verstehe ich als kulturwissenschaftlich. Ausgangspunkt sind stets die kunsthistorischen Objekte in ihren materiell-technischen und stilistischen Eigenheiten als Teil eines kulturellen Horizontes in Hinblick auf soziale und historisch-politische sowie ideen- und mentalitätsgeschichtliche Implikationen. Dabei beziehe ich randständige Werke und Artefakte, die außerhalb des klassischen kunsthistorischen Kanons liegen, ebenso mit ein, wie schriftliche Quellen verschiedener Genres und Sprachen. Dazu ist eine kritisch reflektierte Herangehensweise, ein interdisziplinärer Ansatz und der Einbezug historischer wie systematischer Arbeitsmethoden notwendig. Als wichtigen und an Bedeutung zunehmenden Aspekt meiner Forschung sehe ich den Einbezug von Tools der digitalen Kunstgeschichte bzw. Geisteswissenschaft, wie Datenbanken für Handschriften, schriftliche Quellen oder andere Objekte.
Mich beschäftigen vor allem phänomenologische Fragestellungen nach Funktionen und konkreten Kontexten von Werken sowie ihrer Rezeption durch die Zeitgenossen. In meinen bisherigen Forschungen konnte ich mich anhand von gewählten Schwerpunkten vor allem mit religiöser aber auch profaner Kunst im nordalpinen Raum vom Frühmittelalter bis zur Reformationszeit beschäftigen, in einem Spektrum, das vor allem Tafel- und Buchmalerei, jedoch auch Skulptur, Architektur und Werke angewandter Kunst wie Metall- oder Textilarbeiten umfasst. Mir ist zudem daran gelegen, auch anderen Disziplinen, die sich mit mittelalterlicher Geistesgeschichte befassen, Anregungen und Anknüpfungspunkte für eigene Forschungen zu geben. Auch in diesem Sinne verstehe ich mich als Teil des aktuellen Forschungsdiskurses zur Kunst und Kultur des Mittelalters und schätze den Austausch mit WissenschaftlerInnen im In- und Ausland sehr; dies geschieht zum Teil bilateral bzw. auf dem jährlichen IMC in Leeds, in einem freien Netzwerk zu Praxis und Medialität des Gebets sowie im Arbeitskreis niederländische Kunst- und Kulturgeschichte.

Lehrkonzept
Lehre bedeutet für mich, die Studierenden zu einem zielgerichteten, methodisch reflektierten und diskursiven Umgang mit der Fachmaterie anzuleiten, ihnen fachliches Wissen zu vermitteln und eigenen Wissenserwerb zu katalysieren, sowie sie mit akademischen Schlüsselkompetenzen und wissenschaftlichen Arbeitsmethoden vertraut zu machen. Dabei strebe ich eine möglichst gegenstandsnahe und praxisorientierte Methodik der Vermittlung an.
Meine Rolle als Dozentin definiere ich daher über diejenige als Wissensvermittlerin hinaus als die einer Gesprächspartnerin und Moderatorin innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses mit und zwischen den Studierenden, sowie als Beraterin für fachliche und methodische Fragen. Besonders wichtig ist es mir, die Lernmotivation der Studierenden zu fördern, ihren Enthusiasmus gegenüber fachlichen Inhalten zu wecken, sie auf ihr eigenes Vermögen/Potential bei der Teilnahme an einem wissenschaftlichen Diskurs – sei es in Form eines Seminarbeitrags oder einer schriftlichen Hausarbeit – hinzuweisen.
Die Schaffung einer kooperativen und partizipativen Lernatmosphäre durch den Einsatz von Gruppen- und Partnerarbeit, sowie ein aktivierender Einbezug der Studierenden bei Frontalkonstellationen ist dazu Voraussetzung. Innerhalb der Veranstaltungen wird großer Wert auf Kontakt unter den Studierenden gelegt, sowie ebenso auf den Kontakt zwischen mir und den Studierenden; die Studierenden werden neben der Anleitung zum eigenständigen Arbeiten auch außerhalb des Veranstaltungskontextes zur Zusammenarbeit ermutigt. Unterstützend und beratend stehe ich als Lehrperson diesen Prozessen zur Seite, wobei individuelle Lernstile ebenso innerhalb der Veranstaltungen berücksichtigt werden, bspw. durch den Einsatz von alternativen Lern-und Prüfungsmethoden (Portfolioarbeit, simultane Referate mit Posterpräsentation, Blogs, Gruppenarbeiten mit verteilten Verantwortlichkeiten). Diese Methoden werden auf die Fachinhalte ebenso wie auf die Studienphase der Studierenden abgestimmt eingesetzt und fördern die Selbstwahrnehmung der Studierenden als Fachexperten und Verantwortliche für bestimmte Veranstaltungsabschnitte; dadurch, ebenso wie durch verschiedene Gruppenarbeits-, Referats- und Präsentationsformen werden Vorbehalte und Hemmungen der Studierenden gegenüber jenen fachlichen und diesen methodischen Schlüsselkompetenzen (reflektierter Umgang mit den Tools der Digital Humanities, Präsentieren, Teamarbeit, Arbeitsorganisation, Selbst- und Zeitmanagement etc.) abgebaut. Ebenso findet dadurch eine Sensibilisierung für die Wichtigkeit selbstverantwortlichen Lernens statt.
Dabei wird von meiner Seite zudem großer Wert auf einen möglichst hohen Praxisbezug in den Veranstaltungen gelegt (Besuch von Museen, Kirchen und Bauten im Stadtraum, Bibliotheken und Archiven etc. um Kunstwerke im Original zu analysieren), als auch auf die Aneignung moderner Hilfsmittel und Methoden für die kunsthistorische Forschung (Internet-Datenbanken, Blogs, neue Präsentationsmethoden, etc.). Es ist für mich wichtig, meine eigenen Lehr/Lernmethoden zu reflektieren und auf die Wirksamkeit in Bezug auf die zu vermittelnden Fachinhalte zu überprüfen.
Aus hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahmen und dem Austausch mit (Fach-)KollegInnen ist es mir möglich, Anregungen für die eigene Lehre zu ziehen. Erkenntnisse und Bedarfe werden aus Lehrevaluationen erhoben und in folgende Veranstaltungen integriert. Das Themenspektrum meiner Veranstaltungen bewegt sich innerhalb der Kunstgeschichte und legt vor allem Wert auf eine intensive Heranführung der Studierenden an ikonografische, stilistische und methodische Aspekte der Werke und ihres Kontextes.
Meine eigene Forschung ist geprägt durch dezidiert interdisziplinäre, kulturwissenschaftliche und ideengeschichtliche Herangehensweisen, die Fragen nach Kontext, Funktion sowie nach kunsttechnischen Aspekten stehen bei mir im Fokus. In der Lehre ist es mir ein Anliegen, diese Interessen mit einzubringen, zu verfolgen und den Studierenden als wichtige Sichtweisen kunsthistorischen Arbeitens zu vermitteln.
Lehrerfahrung
Seit 2020: didaktische Gesamtverantwortung für sowie Lehre in verschiedenen Formaten des Curriculums des Goethe-Orientierungsstudiums - u.a. Moderation und Durchführung versch. Veranstaltungen, Ringvorlesungen, Durchführung von Workshops, Betreuung von Portfolio-Arbeiten etc.
Seminar: Praktisches Bildwissen, WS21/22 (2 SWS, versch. ECTS) [Mit Peter Gorzolla, Historisches Seminar]
Seminar: Biblische Texte und Motive zwischen Theologie und Kunstgeschichte, SoSe 19 (2 SWS, versch. ECTS) [Mit Malte Dücker, Fb 06]
Übung: mittelalter/film/bilder (2 SWS, versch. ECTS) [Mit Peter Gorzolla, Historisches Seminar]
Hauptseminar mit Exkursion: Altniederländische Malerei, SoSe 18 (2 SWS, 8 ECTS)
Übung: Schätze und Objekte im Mittelalter, SoSe 18 (2 SWS, versch. ECTS)
Projektseminar: Text und Bild im Mittelalter, WS 17/18 (2 SWS, versch. ECTS)
Oberseminar/Hauptseminar: Kunst um 1400, SoSe 17 (2 SWS, versch. ECTS)
Übung/Proseminar: Sakralarchitektur im Mittelalter, SoSe 15 u. SoSe 17 (2 SWS, versch. ECTS)
Projektseminar und Posterausstellung: Himmel, Hölle, Fegefeuer in mittelalterlichen Kunst und Vorstellungswelt, WS 16/17 (2 SWS, versch. ECTS)
Übung: Hieronymus Bosch, WS 16/17 (2 SWS, 6 ECTS)
Proseminar: Performativität in Kunst und Kultur des Mittelalters, SoSe 16 (2 SWS, 7 ECTS)
Übung: Theorien und Methoden der Kunstgeschichte, SoSe 16 (2 SWS, 6 ECTS)
Übung: Christliche Ikonografie mittelalterlicher Kunst, WS 15/16 (2 SWS, 6 ECTS)
Projektseminar und Posterausstellung: Buchmalerei im Mittelalter, WS 15/16 (2 SWS)
Oberseminar/Hauptseminar: Persönliche Frömmigkeit im Mittelalter, SoSe 15 (2-3 SWS, versch. ECTS)
Proseminar mit begleitender Exkursion „Kunst im Mittelalter – Gattungen, Techniken, Orte, Themen, Personen“, WS 14/15 (2 SWS, 7 ECTS); 3 tägige Exkursion
Proseminar „Apokalypse und Weltgericht in mittelalterlicher Kunst und Vorstellungswelt“, SoSe 14 (2 SWS, 7 ECTS)
Propädeutikum „Wissenschaftliche Arbeitsweisen und Methoden der Kunstgeschichte“, WS 12/13 – WS 14/15 (jeweils 2 SWS, 9 ECTS)
Proseminar (in Lehrkollaboration mit FB 06 der Goethe-Universität Evangelische Theologie) „Die Bibel in Wort und Bild“, WS 13/14 (2 SWS, 7 ECTS)
Proseminar „Immer wieder Endzeit? Darstellungen der Apokalypse im Mittelalter“, SoSe 10 (2 SWS)
Organisation/Durchführung von Workshops und Weiterbildungen zu Fragen der Lehre
Februar 2015 Konzeption des 1. Akademischen Speeddatings zur Bildung interdisziplinärer Lehrkooperationen an der Goethe-Universität, halbtätige Veranstaltung in Kooperation mit dem Schreibzentrum. Die Veranstaltung selbst konnte leider nicht stattfinden.
SoSe 14 und WS 14/15 Organisation des Workshop-Formats „Lehrlabor“ für alle geisteswissenschaftlichen Fachbereiche der Goethe-Universität, 2-stündig, 3-4 Mal im Semester, im Rahmen der vertr. Koordination des Zentrums Geisteswissenschaften
Seit WS 13/14 fachspezifische Weiterbildungen für TutorInnen der Kunstgeschichte zu verschiedenen Themen, z.B. „aktivierende Methoden“, „Konflikte in der Lehre“, „Vortragskompetenz von Studierenden fördern“, 2-stündig, 2 Mal im Semester in Frankfurt; unregelmäßig in Marburg
SoSe 13 Großveranstaltungen in den Geisteswissenschaften, halbtägiger Workshop in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Kolleg Hochschuldidaktik der GU Frankfurt
Teilnahme an Weiterbildungen
SoSe 17 Summer School „Verwaltung und Wissenschaftsmanagement. Überblick und Perspektiven für Einsteiger“ der Marburg University Research Academy (MARA)
WS 14/15 Erwerb des Zertifikats Hochschullehre der Goethe-Universität (21 ECTS)

Akademischer Lebenslauf
- Seit 09/2018 Wissenschaftliche Koordination des Projekts „Orientierungsstudium Geistes- und Sozialwissenschaften“
- 2015-2018 Wissenschaftliche Assistenz, Kunstgeschichtliches Institut, Philipps-Universität Marburg
- 2014-15 vertretungsweise Koordination des Zentrums Geisteswissenschaften im BMBF-Programm "Starker Start"
- 2012-2015 Mitarbeiterin am BMBF-Programm "Starker Start ins Studium", Kunstgeschichtliches Institut der Goethe-Universität Frankfurt
- 2013 Promotion "Das altniederländische Stifterbild. Emotionsstrategien des Sehens und der Selbsterkenntnis", ausgezeichnet mit dem Benvenuto Cellini-Preis durch die Benvenuto Cellini-Gesellschaft
- 2010 Assistenzvertretung am Lehrstuhl von Prof. M. Büchsel, Kunstgeschichtliches Institut, Goethe-Universität Frankfurt
- 2007-2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstgeschichtlichen Institut, Goethe-Universität: DGF-Projekt "Fühlen und Erkennen. Kognitive Funktionen der Darstellung von Emotionen in der mittelalterlichen Kunst"
- 2001-2007 Studium der Fächer Kunstgeschichte sowie Mittlere und Neuere Geschichte, Goethe-Universität Frankfurt
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity