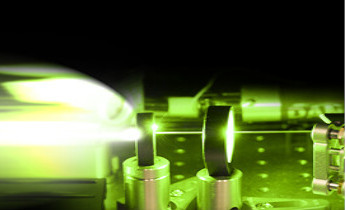Pflichtmodule im Bachelorstudiengang Physik
| Modul |
Lehrveranstaltung |
CP |
| VEX1 |
Experimentalphysik 1: Mechanik, Thermodynamik |
10 |
| VEX2 |
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik |
8 |
| VEX3A |
Experimentalphysik 3a: Optik |
4 |
| VEX3B |
Experimentalphysik 3b: Atome und Quanten |
4 |
| VEX4A |
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen |
4 |
| VEX4B |
Experimentalphysik 4b: Festkörper |
4 |
| PEX1 |
Anfängerpraktikum 1 |
6 |
| PEX2 |
Anfängerpraktikum 2 |
6 |
| PEXF |
Fortgeschrittenenpraktikum |
12 |
| Modul |
Lehrveranstaltung |
CP |
| VTH1 |
Theoretische Physik 1: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik |
8 |
| VTH2 |
Theoretische Physik 2: Klassische Mechanik |
8 |
| VTH3 |
Theoretische Physik 3: Klassische Elektrodynamik |
8 |
| VTH4 |
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik |
8 |
| VTH5 |
Theoretische Physik 5: Thermodynamik und Statistische Physik |
8 |
| VPROG |
Einführung in die Programmierung für Studierende der Physik |
6 |
| Modul |
Lehrveranstaltung |
CP |
| VMATH1 |
Mathematik für Studierende der Physik 1 |
8 |
| VMATH2 |
Mathematik für Studierende der Physik 2 |
8 |
| VMATH3 |
Mathematik für Studierende der Physik 3 |
8 |
| Modul |
Lehrveranstaltung |
CP |
| EWA |
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten |
6 |
| BA |
Bachelorarbeit |
12 |
Zur Vorbereitung der
Bachelorarbeit werden typischerweise ab dem 4. Semester
Wahlpflichtlehrveranstaltungen in dem Fachgebiet absolviert, in dem die
Arbeit angefertigt werden soll. Die Auswahl des Gebiets für die
Bachelorarbeit bleibt dabei grundsätzlich den Studierenden überlassen.
Im Rahmen der Bachelorarbeit selbst werden die Studierenden in eine der
Arbeitsgruppen des Fachbereichs integriert. Alle am Fachbereich
vertretenen Forschungsrichtungen bieten auch Bachelorarbeiten an. Den
Studierenden eröffnet sich damit ein weites Spektrum von
Forschungsfeldern, nicht nur in den Schwerpunkten des Fachbereichs, der
Physik der elementaren und der kondensierten Materie, sondern auch in
den Bereichen Astrophysik/Kosmologie, Atomphysik, Beschleunigerphysik,
Laserphysik, Quantengase, Quantenoptik und Neuroscience. Die meisten
dieser Felder sind sowohl experimentell als auch in der Theorie
vertreten. In vielen Fällen werden die Studierenden während ihrer
Bachelorarbeit in internationale Kooperationen eingebunden. Durch die
enge Zusammenarbeit vieler Forschergruppen mit der Gesellschaft für
Schwerionenforschung (Darmstadt), aber auch durch Experimente am CERN
und DESY (Hamburg), können Studierende während ihrer Bachelorarbeit auch
in Großforschungseinrichtungen hineinschnuppern.