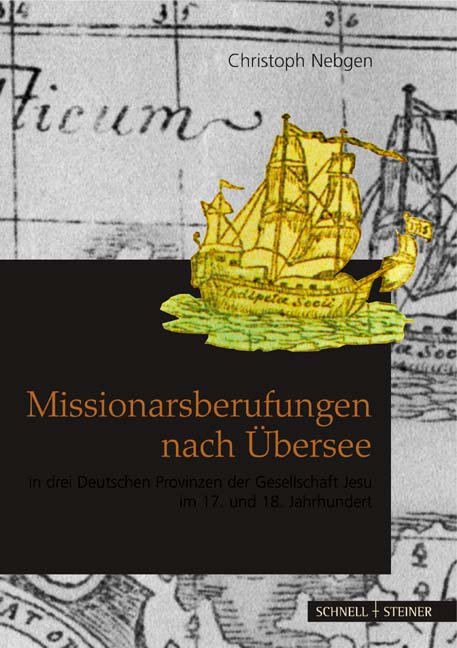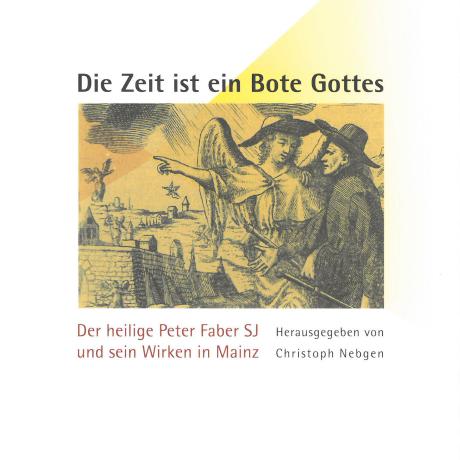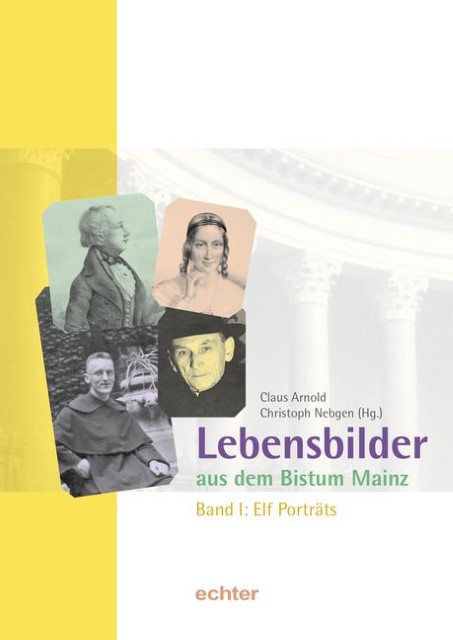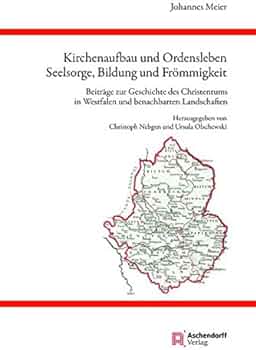Jubiläumstagung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte am 10. und 11. November 2023

Weitere Informationen finden Sie im Flyer hier:

Das Blockseminar findet während der Vorlesungszeit statt; Terminfestlegung nach Anmeldungsende. Die Exkursion wird vom 1. bis 7. September 2024 durchgeführt.Inhalt:
Das Seminar mit Exkursion erschließt „Rom als Stadt der Päpste“ von der Phase erster echter christlicher Bauaktivität im 4. Jahrhundert bis zu den Baumaßnahmen unserer Zeit. Im Seminar und vor Ort soll ein Gespür für die Entwicklung des päpstlichen Roms geweckt werden: von scheinbar banalen Herausforderungen wie der Wasserversorgung einer Pilgerstadt über den Umgang mit religiösen Minderheiten und deren städtebaulicher Berücksichtigung (römisches Ghetto), über die Prachtentfaltung und die Repräsentationszwänge insbesondere der Frühen Neuzeit bis hin zum Verlust der päpstlichen Hoheit über die Stadt im Zuge des Risorgimento, der urbanistischen Konkurrenz von "italienisch-nationalem " und "päpstlichem" Rom, der Inszenierung der "Conciliazione" mit Italien im 20. Jahrhundert, bis hin zu den modernen Bedürfnissen der Betreuung der Pilgerströme. Dabei werden sowohl kulturwissenschaftlich-urbanistische als auch historisch-theologische Deutungsansätze herangezogen (z.B. "Rom als Stadt der Gnade"; G. Wassilowsky).
Empfohlene Literatur:
Richard Krautheimer, Three Christian Capitals. Topography and Politics, Berkeley 1983.
Erwin Gatz, Roma Christiana. Vatikan - Rom - römisches Umland. Ein kunst- und kulturgeschichtlicher Führer, Regensburg, 2. Aufl. 2008.
Zusätzliche Informationen:
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Prof. Dr. Claus Arnold) und der KHG Frankfurt (Gabriele von Erdmann). Die maximale Teilnehmerzahl beträgt insgesamt 16 Studierende aus beiden Universitäten.
Für die Exkursion fallen Kosten von Euro 300,- an; sie decken die Unterbringung mit Frühstück in der zentral gelegenen Casa Valdese in Rom ab (Dreier- und Viererzimmer). Die An- und Abreise wird von den Studierenden individuell organisiert (Anreise am 1.9. bis 18 Uhr, Abreise am 7.9. nach dem Frühstück). Die Kosten für Eintritte und Führungen in Rom werden durch Zuschüsse bestritten.

Prof. Dr. Christoph Nebgen
E-Mail: nebgen@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeit: Dienstag 10-11 Uhr oder nach Vereinbarung per Mail, gerne auch digital
Büro: NG 2.713
Telefon:
Professor Nebgen ist seit dem Sommersemester 2023 an der Goethe Universität Professor für den Lehrstuhl Kirchengeschichte.
Einen ausführlichen Werdegang finden Sie hier:
Herausgeberschaften
Mitgliedschaften
- Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte
- Görres-Gesellschaft
- Internationales Institut für missionswissenschaftliche Forschungen (IIMF)
- Jesuitica e.V.
- Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum
- Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart
- Caspar Olevian-Gesellschaft Trier
- Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa (ARKUM)
- Société internationale d'études jésuites
- Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts
- Forschungszentrum für Historische Geisteswissenschaften (Goethe-Universität)
- Mitglied im Kuratorium von ICALA - Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland (seit September 2023)
- Scientific Board des Projekts „Digital Indipetae Database" am Institute for Advanced Jesuit Studies Boston College
- Mitantragsteller des DFG-Netzwerks "Grenzgänger im „Paraquarischen Blumengarten“. Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz und die Reduktionen Paraguays im 17. und 18. Jahrhundert (2022-2025
Professor Nebgen ist seit dem Sommersemester 2023 an der Goethe Universität Professor für den Lehrstuhl Kirchengeschichte.
Einen ausführlichen Werdegang finden Sie hier:
Herausgeberschaften
Mitgliedschaften
- Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte
- Görres-Gesellschaft
- Internationales Institut für missionswissenschaftliche Forschungen (IIMF)
- Jesuitica e.V.
- Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum
- Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart
- Caspar Olevian-Gesellschaft Trier
- Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa (ARKUM)
- Société internationale d'études jésuites
- Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts
- Forschungszentrum für Historische Geisteswissenschaften (Goethe-Universität)
- Mitglied im Kuratorium von ICALA - Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland (seit September 2023)
- Scientific Board des Projekts „Digital Indipetae Database" am Institute for Advanced Jesuit Studies Boston College
- Mitantragsteller des DFG-Netzwerks "Grenzgänger im „Paraquarischen Blumengarten“. Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz und die Reduktionen Paraguays im 17. und 18. Jahrhundert (2022-2025

Sprechzeit: nach Vereinbarung
Büro: NG 2.716
Telefon: 069 / 798 - 33328
Elisa Frei ist seit Mai 2022 wissenschaftliche
Mitarbeiterin (post-doc) am Fachbereich Katholische Theologie der Goethe-Universität.
Sie arbeitet in Teilzeit auch als project
assistant in der Digital Indipetae
Database, entwickelt vom Institute for Advanced Jesuit Studies (Boston
College, USA), wo sie ein Jahr als junior
fellow verbrachte.
Sie promovierte im November 2017 in Geschichte an der
Universität Triest (Italien); während ihres Promotionsstudiums verbrachte sie
ein Semester (2015) als associate
research student an der University of York (UK). Sie erhielt ihren
Bachelor-Abschluss in Archivwissenschaft und Bibliothekswesen (Universität
Trient, 2006) und den Master-Abschluss in Philologie und literarischer
Hermeneutik (Universität Verona, 2014). Sie besuchte die Schule für
Archivierung, Paläographie und Diplomatik im Staatsarchiv Bozen und ist
diplomierte Archivarin.
Geschichte der Gefühle
Ego-Dokumente der Frühen Neuzeit
Übersee-Missionen der Gesellschaft Jesu
Migration und Wissenstransfer
Außereuropäische Kirchengeschichte
Globale Geschichte
Digitale Geisteswissenschaften
Elisa Frei ist seit Mai 2022 wissenschaftliche
Mitarbeiterin (post-doc) am Fachbereich Katholische Theologie der Goethe-Universität.
Sie arbeitet in Teilzeit auch als project
assistant in der Digital Indipetae
Database, entwickelt vom Institute for Advanced Jesuit Studies (Boston
College, USA), wo sie ein Jahr als junior
fellow verbrachte.
Sie promovierte im November 2017 in Geschichte an der
Universität Triest (Italien); während ihres Promotionsstudiums verbrachte sie
ein Semester (2015) als associate
research student an der University of York (UK). Sie erhielt ihren
Bachelor-Abschluss in Archivwissenschaft und Bibliothekswesen (Universität
Trient, 2006) und den Master-Abschluss in Philologie und literarischer
Hermeneutik (Universität Verona, 2014). Sie besuchte die Schule für
Archivierung, Paläographie und Diplomatik im Staatsarchiv Bozen und ist
diplomierte Archivarin.
Geschichte der Gefühle
Ego-Dokumente der Frühen Neuzeit
Übersee-Missionen der Gesellschaft Jesu
Migration und Wissenstransfer
Außereuropäische Kirchengeschichte
Globale Geschichte
Digitale Geisteswissenschaften

Mario Adam
E-Mail: adam@em.uni-frankfurt.de
Mario Adam studiert gegenwärtig den Bachelor Geschichte im
Hauptfach, Philosophie und Katholische Theologie im Nebenfach an der
Goethe-Universität Frankfurt. Seit dem Sommersemester 2023 arbeitet er als
studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Kirchengeschichte und am Lehrstuhl
Fundamentaltheologie und Dogmatik. Für Sprechstunden
oder mit Fragen und Unterstützungswünschen können Sie sich jederzeit per Mail
melden.

Clara Berndt
E-Mail: clara.berndt@stud.uni-frankfurt.de
Clara Berndt studiert
Lehramt für Grundschulen (L1) mit den Fächern Katholische Religion, Deutsch und Mathe. Seit dem Sommersemester 2022 arbeitet sie als studentische
Hilfskraft am Lehrstuhl für Kirchengeschichte. Sie ist für die Website
zuständig. Bei Fragen können Sie sich per Mail melden

Prof. Dr. Christoph Nebgen
E-Mail: nebgen@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeit: Dienstag 10-11 Uhr oder nach Vereinbarung per Mail, gerne auch digital
Büro: NG 2.713
Telefon:
Professor Nebgen ist seit dem Sommersemester 2023 an der Goethe Universität Professor für den Lehrstuhl Kirchengeschichte.
Einen ausführlichen Werdegang finden Sie hier:
Herausgeberschaften
Mitgliedschaften
- Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte
- Görres-Gesellschaft
- Internationales Institut für missionswissenschaftliche Forschungen (IIMF)
- Jesuitica e.V.
- Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum
- Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart
- Caspar Olevian-Gesellschaft Trier
- Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa (ARKUM)
- Société internationale d'études jésuites
- Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts
- Forschungszentrum für Historische Geisteswissenschaften (Goethe-Universität)
- Mitglied im Kuratorium von ICALA - Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland (seit September 2023)
- Scientific Board des Projekts „Digital Indipetae Database" am Institute for Advanced Jesuit Studies Boston College
- Mitantragsteller des DFG-Netzwerks "Grenzgänger im „Paraquarischen Blumengarten“. Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz und die Reduktionen Paraguays im 17. und 18. Jahrhundert (2022-2025
Professor Nebgen ist seit dem Sommersemester 2023 an der Goethe Universität Professor für den Lehrstuhl Kirchengeschichte.
Einen ausführlichen Werdegang finden Sie hier:
Herausgeberschaften
Mitgliedschaften
- Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte
- Görres-Gesellschaft
- Internationales Institut für missionswissenschaftliche Forschungen (IIMF)
- Jesuitica e.V.
- Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum
- Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart
- Caspar Olevian-Gesellschaft Trier
- Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa (ARKUM)
- Société internationale d'études jésuites
- Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts
- Forschungszentrum für Historische Geisteswissenschaften (Goethe-Universität)
- Mitglied im Kuratorium von ICALA - Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland (seit September 2023)
- Scientific Board des Projekts „Digital Indipetae Database" am Institute for Advanced Jesuit Studies Boston College
- Mitantragsteller des DFG-Netzwerks "Grenzgänger im „Paraquarischen Blumengarten“. Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz und die Reduktionen Paraguays im 17. und 18. Jahrhundert (2022-2025

Sprechzeit: nach Vereinbarung
Büro: NG 2.716
Telefon: 069 / 798 - 33328
Elisa Frei ist seit Mai 2022 wissenschaftliche
Mitarbeiterin (post-doc) am Fachbereich Katholische Theologie der Goethe-Universität.
Sie arbeitet in Teilzeit auch als project
assistant in der Digital Indipetae
Database, entwickelt vom Institute for Advanced Jesuit Studies (Boston
College, USA), wo sie ein Jahr als junior
fellow verbrachte.
Sie promovierte im November 2017 in Geschichte an der
Universität Triest (Italien); während ihres Promotionsstudiums verbrachte sie
ein Semester (2015) als associate
research student an der University of York (UK). Sie erhielt ihren
Bachelor-Abschluss in Archivwissenschaft und Bibliothekswesen (Universität
Trient, 2006) und den Master-Abschluss in Philologie und literarischer
Hermeneutik (Universität Verona, 2014). Sie besuchte die Schule für
Archivierung, Paläographie und Diplomatik im Staatsarchiv Bozen und ist
diplomierte Archivarin.
Geschichte der Gefühle
Ego-Dokumente der Frühen Neuzeit
Übersee-Missionen der Gesellschaft Jesu
Migration und Wissenstransfer
Außereuropäische Kirchengeschichte
Globale Geschichte
Digitale Geisteswissenschaften
Elisa Frei ist seit Mai 2022 wissenschaftliche
Mitarbeiterin (post-doc) am Fachbereich Katholische Theologie der Goethe-Universität.
Sie arbeitet in Teilzeit auch als project
assistant in der Digital Indipetae
Database, entwickelt vom Institute for Advanced Jesuit Studies (Boston
College, USA), wo sie ein Jahr als junior
fellow verbrachte.
Sie promovierte im November 2017 in Geschichte an der
Universität Triest (Italien); während ihres Promotionsstudiums verbrachte sie
ein Semester (2015) als associate
research student an der University of York (UK). Sie erhielt ihren
Bachelor-Abschluss in Archivwissenschaft und Bibliothekswesen (Universität
Trient, 2006) und den Master-Abschluss in Philologie und literarischer
Hermeneutik (Universität Verona, 2014). Sie besuchte die Schule für
Archivierung, Paläographie und Diplomatik im Staatsarchiv Bozen und ist
diplomierte Archivarin.
Geschichte der Gefühle
Ego-Dokumente der Frühen Neuzeit
Übersee-Missionen der Gesellschaft Jesu
Migration und Wissenstransfer
Außereuropäische Kirchengeschichte
Globale Geschichte
Digitale Geisteswissenschaften

Mario Adam
E-Mail: adam@em.uni-frankfurt.de
Mario Adam studiert gegenwärtig den Bachelor Geschichte im
Hauptfach, Philosophie und Katholische Theologie im Nebenfach an der
Goethe-Universität Frankfurt. Seit dem Sommersemester 2023 arbeitet er als
studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Kirchengeschichte und am Lehrstuhl
Fundamentaltheologie und Dogmatik. Für Sprechstunden
oder mit Fragen und Unterstützungswünschen können Sie sich jederzeit per Mail
melden.

Clara Berndt
E-Mail: clara.berndt@stud.uni-frankfurt.de
Clara Berndt studiert
Lehramt für Grundschulen (L1) mit den Fächern Katholische Religion, Deutsch und Mathe. Seit dem Sommersemester 2022 arbeitet sie als studentische
Hilfskraft am Lehrstuhl für Kirchengeschichte. Sie ist für die Website
zuständig. Bei Fragen können Sie sich per Mail melden
Kirchengeschichte im Dialog von Orts- und
Weltkirche
Mit diesem Konzept
kann man die maßgeblichen Forschungsinteressen wie auch den methodischen Ansatz
im Bereich der Kirchengeschichte treffend umschreiben, der am Frankfurter
Lehrstuhl für Kirchengeschichte Anwendung findet. Zugleich bietet diese
Formulierung eine gute Anschlussmöglichkeit an das Konzept einer „entangled
history“, wie es in der aktuellen historiographischen Debatte für die
Beschreibung (post-)kolonialer Prozesse benutzt wird. Historische Transfer- und
Begegnungsprozesse laufen nie nur in eine Richtung ab, sondern haben Aus- und
Rückwirkungen auf alle Akteure, selbst auf den scheinbar unbeteiligten
Betrachter. Dieses Modell einer miteinander „verwobenen Geschichte“ besitzt in
ganz unterschiedlichen historischen Kontexten und Epochen eine starke
Erklärungskraft. Aus theologischer Perspektive kann man diese Lesart der
Kirchengeschichte ergänzen, indem man die gesamte Christentumsgeschichte als Inkulturationsgeschichte begreift. So wie ein kulturloses Christentum nicht
vorstellbar und es somit abhängig ist von einem „kulturellen Träger“, prägt
umgekehrt der christliche Glaube die Kulturen, mit denen er in Kontakt tritt,
in unterschiedlichster Art und Weise. Diese Sichtweise hat auch Konsequenzen
für das hieraus abgeleitete Kirchenbild, denn eine einzige allgemeingültige
kulturelle Norm des Christseins kann so nicht mehr weiter begründet werden. Die
lange Zeit vorherrschende europäische – oder gar römische – Prägung des Christentums
mit ihrem Alleinvertretungsanspruch muss unter der Prämisse der
Inkulturationsthese immer wieder neu ausgehandelt und angepasst werden. Dies
gilt nicht nur auf Ebene der Weltkirche, sondern durchaus auch für manche
Phänomene im binnenkulturellen Kontext postmoderner Gesellschaften. Dieses
Verständnis einer globalen Christentumsgeschichte, die im Dialog der Erfahrungen der unterschiedlichen
Ortskirchen entsteht steht im Zentrum der Aktivitäten des Lehrstuhls.

Von links: Benjamin Emmrich,
Mainz; Dr. Lisa Herrmann-Fertig, Nürnberg; Dr. Maximiliano von Thüngen,
Köln/Berlin; Dr. Corinna Gramatke, Düsseldorf; Dr. Fabian Fechner, Hagen; PD
Dr. Christiane Birr, Frankfurt a.M.; P. Dr. Niccolo Steiner SJ, Frankfurt a.M.;
Dr. Esther Schmid Heer, Zürich; Prof. Dr. Christoph Nebgen, Frankfurt a.M.; Dr.
Irina Saladin, Tübingen; Prof. Dr. Birgit Emich, Frankfurt a.M:; Dr. Philip
Knäble, Göttingen; Severin Parzinger, Osnabrück; P. Prof. em. Dr. Klaus
Schatz SJ, Frankfurt a.M.; Prof. em. Dr. Johannes Meier, Mainz
Erstes Netzwerktreffen "Grenzgänger im Paraquarischen Blumengarten" am 8. und 9. April 2022
Am 8. und 9. April fand das erste Treffen in Präsenz des von der DFG geförderten wissenschaftlichen Netzwerks "Grenzgänger im „Paraquarischen Blumengarten“. Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz und die Reduktionen Paraguays im 17. und 18. Jahrhundert" an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt statt. Das von Johannes Meier (Mainz), Niccolo Steiner SJ (PTH St. Georgen) und Christoph Nebgen (Goethe-Universität) organisierte Netzwerk vereinigt insgesamt 20 Wissenschaftler verschiedenster kulturwissenschaftlicher Disziplinen aus Deutschland, Italien und der Schweiz, die aktuell zur Thematik arbeiten. Zur Gruppe gehören etwa auch Prof. Dr. Birgit Emich (FB 08) und PD DR. Christiane Birr vom Frankfurter MPI für Rechtsgeschichte. Ziele des Netzwerks sind die Stärkung des interdisziplinären Austauschs, Reaktivierung bestehender Forschungsinfrastruktur, Konzeption und Erarbeitung zweier Monographien und die Organisation einer internationalen Tagung für den Herbst 2024. Schwerpunkt der ersten Sitzung war die Quellenproblematik, die durch einen medizinhistorischen Abendvortrag am Freitag von Dr. Michael M. Schulte (Merck/Darmstadt) zum Thema "Pulvis Jesuiticus - Ein Wundermittel gegen die Malaria-Pandemie des 17.Jahrhunderts" beispielhaft vertieft werden konnte. Auf einer eigenen Homepage wird das Projekt mit seinen aktuellen Forschungen bald vorgestellt werden.
Im Rahmen des DFG-Forschungsprojekt "Grenzgänger im 'Paraquarischen Blumengarten'. Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz und die Reduktionen Paraguays im 17. und 18. Jahrhundert" fand das erste Netzwerktreffen am 8. und 9. April 2022 in der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main statt.

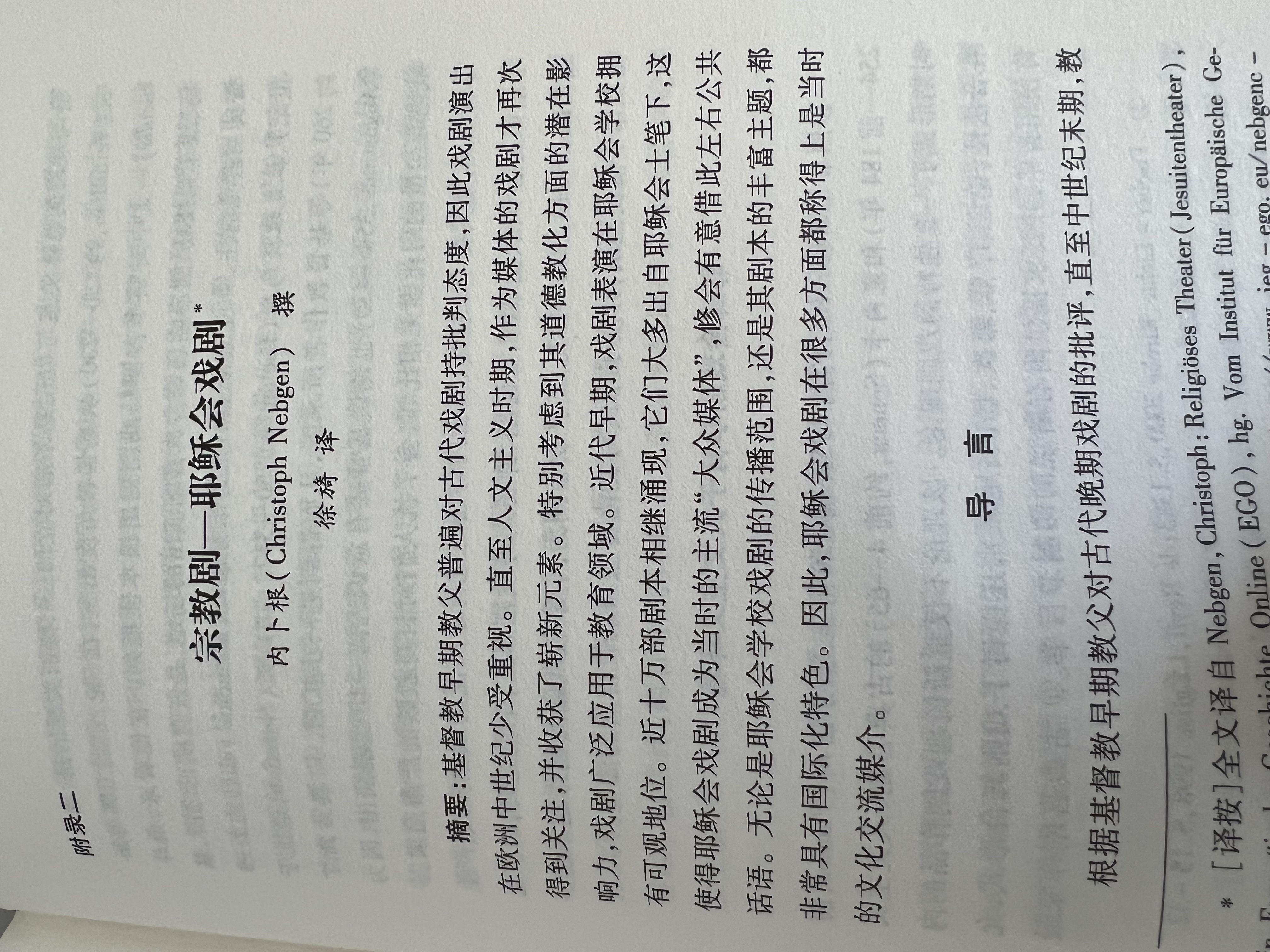
Das neulateinische Bühnendrama Pietas Victrix des Jesuiten
Nicolaus Avancini (1611-1686) gilt als ein Höhepunkt der Theatergeschichte des
17. Jahrhunderts. Bei seiner Uraufführung in Wien waren Tausende von Besuchern
einschließlich des gesamten Kaiserhofes anwesend. Nun ist zum ersten mal eine
Übersetzung ins Chinesische des Dramentextes aus der Feder des an der
Peking-Universität tätigen Germanisten Zhenghua Hu erschienen. Zum besseren
Verständnis für die Bedeutung des Stückes wurde ein bereits im Jahr 2010
erschienener Beitrag von Prof. Christoph Nebgen zum Thema „Religiöses Theater“
ebenfalls übersetzt und in den Band aufgenommen. Weitere Übersetzungen von
Barockdramen am Lehrstuhl der Pekinger Germanistikprofessorin Gu Yu sollen
folgen und die Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Lehrstuhl für
Kirchengeschichte intensiviert werden.
Informationen zu den Veranstaltungen im Wintersemester 2023/24 folgen
Zu zuäzlichen ehemaligen Lehrveranstaltungen informieren sie sich bitte über Moodle und LSF.

PROF. DR. DR. H.C. HUBERT WOLF
E-Mail: hubert.wolf@uni-muenster.de
Telefonnummer:
+49 251 83-22626
Postanschrift: Domplatz 23 | D-48143 Münster
Dienstsitz: Domplatz 23 | Zimmer 417 (4. Etage) |
D-48143 Münster
1992-2000 Ordinarius (C4) für Kirchengeschichte am Fachbereich Katholische
Theologie der Universität Frankfurt/Main, 1996-2000 Mitglied im
Historischen Seminar des Fachbereichs Geschichte
https://www.uni-muenster.de/FB2/personen/mnkg/seminar/wolf.html

UNIV.-PROF. DR. THEOL. CLAUS ARNOLD
E-Mail: claus.arnold@uni-mainz.de
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität Mainz
FB 01, Katholisch-Theologische Fakultät
Abteilung Mittlere und Neuere Kirchengeschichte/
Religiöse Volkskunde
55099 Mainz
In den letzten Jahren in der Lehre tätig

Lic. theol. Manuel Krumbiegel M.Ed.
Tel.: 06131-3923390
Mail: mkrumbiegel@uni-mainz.de
Akademischer Werdegang
2011 – 2016 Studium der Fächer Katholische
Religionslehre, Philosophie/Ethik und Bildungswissenschaften für das Lehramt am
Gymnasium an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
2014 – 2016 Studium des Faches Deutsch für das Lehramt
am Gymnasium an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
2016 Prämierung der Masterarbeit „Fides non ficta. Die
Epistemologie des Glaubens bei Augustinus und Marius Victorinus“ durch das
Gutenberg Lehrkolleg der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
2016 – 2018
Studium des Lizentiates der Katholischen Theologie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
2018 – 2021 Stipendiat der Graduiertenförderung des
Cusanuswerks
Beruflicher Werdegang
2014 – 2015 Wissenschaftliche Hilfskraft im
DFG-Projekt: „Theologie und Sklaverei von der Antike bis zur Frühen Neuzeit“
2015 – 2019 Wissenschaftliche Hilfskraft am Seminar
für Kirchengeschichte, Abt. Altertum und Patrologie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
2016 Vertretungslehrkraft am Gymnasium am Römerkastell
Alzey
2016 – 2017 Wissenschaftliche Hilfskraft im
DFG-Projekt: „Die Rhetorik des Gebets. Studien zur spätantiken lateinischen
Kultsprache“
2017 Praktikum im Lektorat Theologie/Philosophie bei
der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt
2017 Wissenschaftliche Hilfskraft im vom Gutenberg
Lehrkolleg der Johannes Gutenberg-Universität Mainz geförderten Lehrprojekt
„Religiöses Lernen im Web 2.0“
2018 – 2019
Wissenschaftliche Hilfskraft am Seminar für Religionspädagogik,
Katechetik und Fachdidaktik Religion an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz
WiSe 2019/20 Lehrauftrag für Kirchengeschichte an der
Universität Koblenz-Landau, Landau
2020 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt:
„Lexikon gnostischer Mythologumena, Teil II: die patristischen Quellen“ (Dr.
phil. Johanna Brankaer)
2020 – 2021 Wissenschaftliche Hilfskraft am Seminar
für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
2021 Wissenschaftliche Hilfskraft am Seminar für
Kirchengeschichte, Abt. Altertum und Patrologie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
seit 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar
für Kirchengeschichte, Abt. Altertum und Patrologie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Mitgliedschaften
Mitglied des Arbeitskreises Patristik (Forum für
jüngere deutschsprachige Patrologinnen und Patrologen)
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Kirchenhistoriker
und Kirchenhistorikerinnen im deutschen Sprachraum (Nachwuchsgruppe)
Assoziiertes Mitglied am Graduiertenkolleg 2304
„Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und
Rezeption“
Mainzer Forschungen zum Krieg: Byzantinische und
andere Kriegskulturen, zus. mit Heike Grieser, in: WUB 105 (2022) 66f.
Fides non ficta. Die Epistemologie des Glaubens bei
Augustinus, in: WiWei 84 (2021), 206-224.
„Gibt's da nicht 'ne App für?!“, in: KatBl 143, 3
(2018), S. 209f.
Biographie
2001
– 2008 Studien der Geschichte, Katholischen Religionslehre und Biologie (LA Sek
II/I) sowie Mittelalterlichen Geschichte und Frühchristlichen Archäologie
(M.A.) an der Universität Münster
2004
– 2008 Studentische Hilfskraft im Sonderforschungsbereich 496: Symbolische
Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, Projekt: A4: „Die Messe im
späten Mittelalter“
2008
– 2019 Universitätsassistent am Institut für Kirchengeschichte und Patrologie
an der Katholischen Privat-Universität Linz
2009
– 2011 Diplomstudium der Katholischen Theologie an der Katholischen
Privat-Universität Linz
seit
2010 Fachreferent bei den Theologischen Kursen Wien
2011
Forschungsstipendium am Deutschen Historischen Institut in Rom
2012
– 2013 ROM-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am
Österreichischen Historischen Institut in Rom
2015
– 2019 Doktoratsstudium der Katholischen Theologie im Fach Neuere
Kirchengeschichte an der Universität Innsbruck
2018
– 2019 Abschlussstipendium am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in
Mainz
2020
Promotion zum Dr. theol. (Titel der Dissertation: Konzilsrezeption als
Romanisierung: Eine Studie zu Umsetzung und Steuerung der Trienter Reform am
Beispiel der Residenzpflicht durch das posttridentinische Kongregationenwesen
der Römischen Kurie (1563–1680))
2020
– 2022 Referendariat am Studienseminar für Gymnasien in Marburg in den Fächern
Katholische Religion und Geschichte (Ausbildungsschule Stiftsgymnasium St.
Johann in Amöneburg)
seit
2022 Studienrat an der Augustinerschule Friedberg
Forschungsschwerpunkte
·
Katholische
Konfessionskultur der Frühen Neuzeit
·
Rezeptionsgeschichte
des Konzils von Trient
·
Frühneuzeitliche
Papsttums- und Kuriengeschichte
·
(Kirchen-)Geschichtsdidaktik
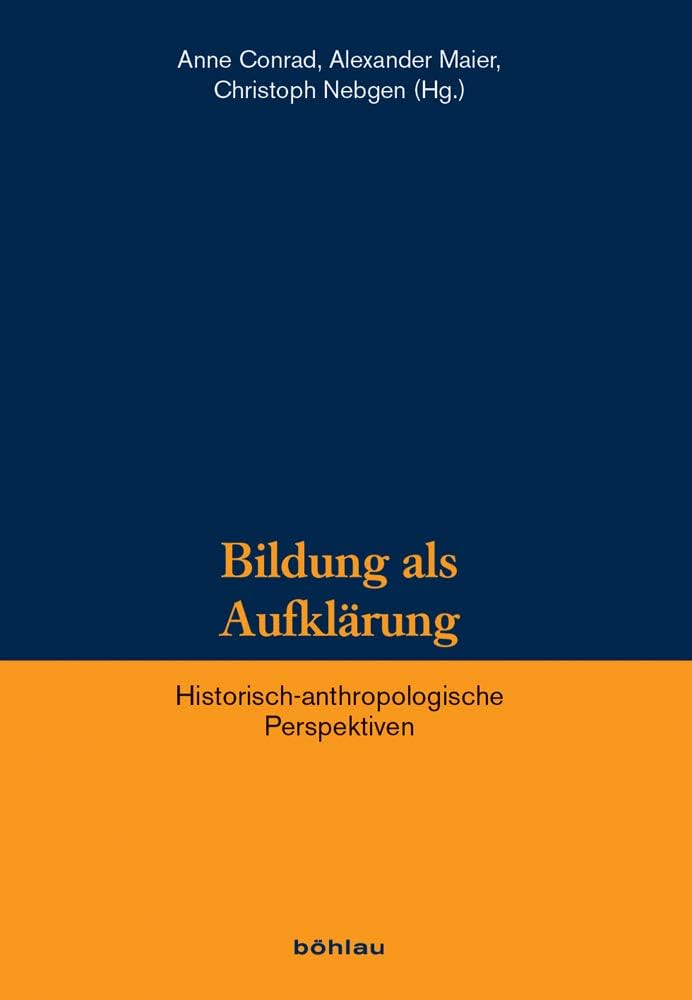
Bildung als Aufklärung. Historisch-anthropologische Perspektiven Göttingen 2020 (= Veröffentlichungen des Instituts für Historische Anthropologie e.V., Bd. 15).
Blog
Keine aktuellen Einträge gefunden