Novellistik des 13.–15. Jahrhunderts. Textauswahl, Übersetzung und Kommentar, hg. v. Katharina Philipowski und Franziska Wenzel, erscheint im Schwabe-Verlag, Basel/Berlin.
Projektleitung: Prof. Dr. Katharina
Philipowski (Uni Potsdam) und Prof. Dr. Franziska Wenzel (GU)
Die Forschung zur Versnovellistik ist mit der rezenten sechsbändigen
Ausgabe »Die Deutsche Versnovellistik des 13.–15. Jahrhunderts« (erschienen
2020) in eine neue, noch weithin offene vielversprechende Phase getreten. Für
einen möglichst breiten, auch studentischen Kreis von Nutzerinnen und Nutzern
möchten wir der nunmehr verfügbaren Materialfülle eine Übersetzung von
ausgewählten Texten mit jeweils einem wissensgeschichtlichen Kommentar zur
Seite stellen, die im Schwabe Verlag erscheinen sollen.
Das Projekt sieht sich drei Zielen verpflichtet:
1. Die im Rahmen des Projektes angefertigten
Übersetzungen sollen die Übersetzungstätigkeit im akademischen Unterricht nicht
erübrigen, sondern Anregungen für den Austausch über Übersetzungsmöglichkeiten
und Deutungen liefern, die jeder Übersetzung immer schon zugrunde liegen.
2. ermöglichen Übersetzungen einen
Zugang für jene, die entweder jenseits des akademischen Umfelds oder auch
jenseits der Germanistik Interesse an den übersetzten Versnovellen haben. Der
Kommentar wird gattungs- und motivgeschichtliches sowie (kultur)historisches
Hintergrundwissen bereitstellen, um so v.a. Studierenden den Zugang zum
Text und die Arbeit an der eigenen Interpretation des Primärtextes zu
erleichtern.
3. Das Projekt versteht sich als Beitrag zum
Wissenschaftstransfer, einerseits in andere Fächer, andererseits aber auch in
die interessierte deutschsprachige Öffentlichkeit. Denn ihr dürfte ungeachtet
der vorliegenden englischen Übersetzungen der Zugang zu den in der »Deutschen
Versnovellistik des 13.–15. Jahrhunderts« edierten Texten ohne Übersetzung und
eingehende Kommentierung weitgehend verschlossen bleiben.
Zur Übersetzung und Kommentierung haben wir Kolleginnen und Kollegen aus
der Germanistischen Mediävistik eingeladen, die sich durch ihre
Forschungsschwerpunkt für die Übernahme von Texten besonders
empfehlen. Eine Veröffentlichung ist für Herbst/Winter 2025 geplant.
LehrFoRM_KuMed: Kulturwissenschaftlich-mediävistische LehrForschung im RMU-Format
Projektleitung: Prof. Dr. Claudia Lauer (JGU) und Prof. Dr. Franziska Wenzel (GU)
Projektmitarbeiter: Davina Beck MA (JGU), Melanie Guth (JGU), Malin Kipke MA (GU), Victoria Link (JGU)
Weitere Ansprechpartner: Anna Chalupa-Albrecht MA (GU); Jan Habermehl MA (JGU / GU), Dr. Birgit Herbers (JGU), Julius Herr, MA (GU); Dr. Mirna Kjorveziroska (JGU)
Laufzeit: 8/2022 – 5/2023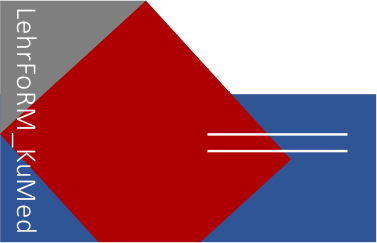
Förderung: RMU-Initiativfonds
Lehre
Nach erfolgreicher Start-Up-Phase, gefördert durch die Freunde der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz und der Goethe-Universität Frankfurt, vertieft das
Projekt die kooperative Weiterentwicklung des bestehenden curricularen Angebots
mit Fokus auf agile Umsetzung, Aktualität und Nachhaltigkeit durch
berufsfeldorientiertes Arbeiten.
In diesem Kontext werden
neben einer eigenen Website eine Reihe von RMU-Werkstätten erarbeitet, die
ergebnisorientiert thematisch neu ausgerichtete philologische Kompetenzen mit
interdisziplinärer kulturwissenschaftlicher Forschung und
editionswissenschaftlicher Arbeit verknüpfen werden. Die Studierenden
überführen die Explorationen unter wissenschaftlicher Betreuung nachhaltig in
Auswahleditionen, um eine digitale studentische Editionsreihe zu etablieren.
Eine zu erarbeitende digitale Vorlesung, die in die alte und neue
Editionsphilologie, Kommentarpraxis und Textredaktion einführt, soll das
regelmäßige Angebot der Werkstätten kongenial ergänzen.
Würgendrüssel und Zugweise. Pilotstudie
Projektleitung: Prof.
Dr. Franziska Wenzel (GUF)
Mitglieder: Prof. Dr. Claudia Lauer (Mainz), Prof. Dr.
Andrea Rapp (Darmstadt)
Projektmitarbeiter: Jan Habermehl, M.A.
Laufzeit: 4/2022 – 3/2023
Förderung: Forschungsfonds FB 10 der GU Frankfurt
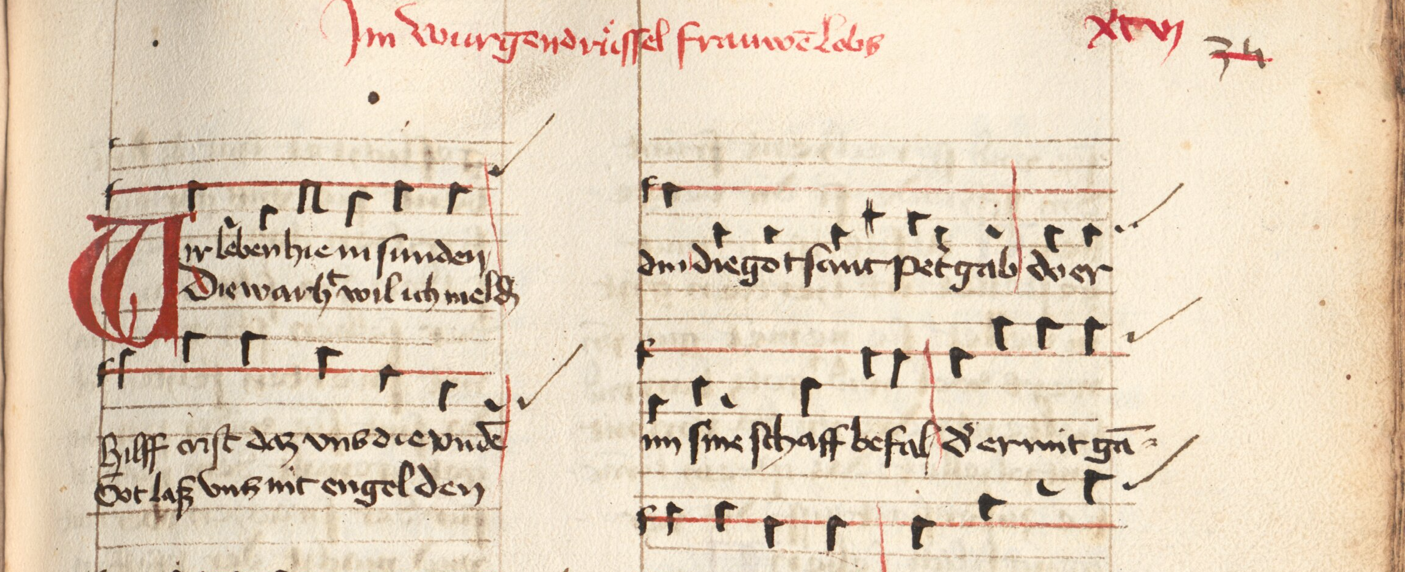 Die als Pilotstudie konzipierte
digitale Edition versteht sich als Auftakt und Vorarbeit zu einem größer
angelegten Drittmittelprojekt im RMU-Verbund zwischen Darmstadt, Mainz und Frankfurt.
Im Rahmen der Anschubförderung werden momentan die beiden Frauenlob-Töne
Würgendrüssel und Zugweise der Kolmarer Liederhandschrift erarbeitet, deren handschriftlich
tonaler Zusammenhang sichtbar gemacht werden und über einen Sachkommentar erschlossen
werden soll.
Die als Pilotstudie konzipierte
digitale Edition versteht sich als Auftakt und Vorarbeit zu einem größer
angelegten Drittmittelprojekt im RMU-Verbund zwischen Darmstadt, Mainz und Frankfurt.
Im Rahmen der Anschubförderung werden momentan die beiden Frauenlob-Töne
Würgendrüssel und Zugweise der Kolmarer Liederhandschrift erarbeitet, deren handschriftlich
tonaler Zusammenhang sichtbar gemacht werden und über einen Sachkommentar erschlossen
werden soll.
(BSB Cgm 4997 – ‚Kolmarer
Liederhandschrift', 116r.)
Handhabe und Anweisung in der Kunstliteratur der Frühen Neuzeit
Projektleitung: Prof. Dr. Christina Lechtermann
Leitung der Forschungsgruppe: Prof. Dr. Magdalena Bushart (TU Berlin)
Laufzeit: 07/2021–07/2024
Förderung: DFG
Das Projekt ist Teil der Berliner Forschungsgruppe 3033: "Dimensionen der techne in den
Künsten. Erscheinungsweisen / Ordnungen / Ökonomien / Narrative"
Commentarial Forms of Literature (Kommentarformen in der Literatur)

Projektleitung: Prof.
Dr. Markus Stock (UoT) / Prof. Dr. Christina Lechtermann
Förderung: DAAD PPP
Programm
Laufzeit: bis Ende 2021
The project
investigates connections between commentary and literature in medieval and
early modern cultures. Scholars in Arabic, German, Jewish, and Romance
literatures at the University of Toronto (UoT) and Goethe University
Frankfurt/Main (GU) will be exploring commentarial forms in literature as
well as commentarial forms to stage literature as an ennobled mode of
written communication.
“Commentarial Forms in
Literature" is a sister grant (DAAD, PPP-Programm) to “Practices of
Commentary". For further information please visit our website at: https://globalcommentary.utoronto.ca
Beteiligte Personen
der Goethe-Universität Frankfurt:
Andrea Baldan (Romanistik), Jennifer Gerber (Ältere deutsche Literatur),
Elisabeth Hollender (Judaistik), Christina Lechtermann (Ältere deutsche
Literatur), Christine Ott (Romanistik), Philip Stockbrugger (Romanistik),
(Ms. lat. qu. 5 - Evangelium Lucae cum
glossa ordinaria, fol. 113r der UB der Goethe-Universität Frankfurt am Main.)
VAS – Vor-Augen-Stellen. Bildliche Kommunikation jenseits der Dichotomie von Sprache und Bild

Projektleitung: Prof. Dr. Franziska Wenzel
Beteiligte: Dr. Henrike Eibelshäuser (Berlin), Prof.Dr. Cornelia Herberichs (Fribourg), Jun.-Prof.Dr. Cornelia Herberichs (Mainz), Dr. Verena Linseis (Gießen), Prof.Dr. Cornelia Logemann (München), Prof.Dr. Henrike Manuwald (Göttingen), Dr. Heike Schlie (Krems/ Salzburg), Dr. Pia Selmayr (Zürich), Jun.Prof.Dr. Beatrice Trînca (Berlin), Prof.Dr. Marius Rimmele (Zürich), Dr. Herfried Vögel (München)
Assoziierte: Dr. Britte Dümpelmann (Berlin), Prof.Dr. Manfred Eikelmann (Bochum), Prof.Dr. Claudia Lauer (Mainz), Dr. Nicola Zotz (München)
Förderung: DFG
Laufzeit: 10/2016–10/2021
Ausführliche Projektbeschreibung
Das interdisziplinäre Forschungsnetzwerk will eine Grammatik bildlicher
Kommunikation erarbeiten und das jenseits der Dichotomie von Sprache und Bild.
Es geht uns um ein gemeinsames Instrumentarium für anschauliche Darstellungen,
die sich im Medium der Sprache und im Medium des Bildes finden. Dafür sollen
die Verfahren des Vor-Augen-Stellens systematisch beschrieben und anhand von
exemplarischen Studien der Netzwerkmitglieder veranschaulicht werden. Der
Ansatz selbst ist durch die Tatsache geleitet, dass das Interesse am Bildlichen
und Visuellen seit iconic und pictorial turn beständig gewachsen ist. Nicht nur
interessieren alle Formen der Bilderzeugung; Sprache und Bild als vernetzte
werden mittlerweile als Teil einer visuellen Kultur erforscht, so wie es in der
germanistisch-mediävistischen Forschungstradition, der Beschreibung textueller
Visualisierungsformen, der Text-Bild-Forschung und der Bedeutungsforschung,
seit langem der Fall ist.
Das Netzwerk ist den modernen und mediävistischen
Bildwissenschaften verbunden, setzt aber bei einem Punkt jenseits der
Opposition von Text und Bild an. Sprache und Bild sind trotz ihrer medialen
Differenz historisch weniger trennscharf gewesen. Zentrale sprachliche
Verfahren der Anschaulichkeit wie Hypotyposis, Vergleich und metaphorische Rede
zielen auf Konkretion mit dem Ziel, einen abwesenden Gegenstand so vor Augen zu
stellen, dass er eindrücklich, klar und lebendig erscheint. Dies ist
bildkünstlerischen Darstellungen ganz vergleichbar, gerade auch, weil der
referentielle Bezug hinter die Evidenz des Augenscheinlichen zurücktritt. Für
das Netzwerk gilt daher grundsätzlich, dass jede Form der Evidenzerzeugung auch
Bedeutungsübertragung ist, insofern sich etwas zeigt, das etwas Abwesendes
bezeichnet. Sprachliches und bildkünstlerisches Vor-Augen-Stellen verlebendigt
und zeigt etwas Abwesendes zugleich. Die referentiellen Bezüge werden von der
Evidenz des In-Erscheinung-Getretenen wirksam verborgen. Wir können hier
konkret an zwei rezente Projekt anschließen, an das seit 2013 existierende
Berliner Projekt BildEvidenz und die seit 1998 laufende Münsteraner
Arbeitsstelle für Christliche Bildtheologie, die das religiöse Bild auf seine
historischen und erkenntnistheoretischen Prämissen in der Auseinandersetzung
mit dem Verhältnis von Wort und Bild untersucht.
Neben den Verfahren des Vor-Augen-Stellens geht es uns um die interaktiven Dimensionen der Bedeutungskonstitution, um die Verweiszusammenhänge zwischen konventionellem Wissen, innermedial umgesetztem Wissen und Vor-Augen-Stehendem, um die Wechselwirkungen zwischen seiner Bedeutung im medialen Kontext und um die Wirkungsweisen im jeweiligen Gebrauchszusammenhang der Medien.
Geometria Deutsch. Druckwerke der praktischen Geometrie bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts
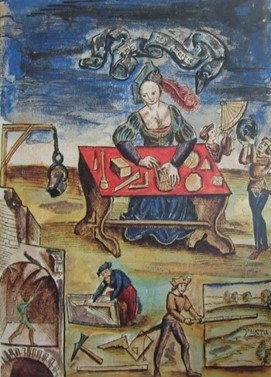
Projektleitung: Prof. Dr. Christina Lechtermann
Laufzeit: 02/2018–08/2021
Förderung: DFG
Projektmitarbeiter: Jan Habermehl, M.A.
Frühneuzeitliche Druckwerke der praktischen Geometrie inszenieren sich in
einem Netz verschiedener Praktiken und reflektieren sich als
Text-Bild-Verbünde, die erst im Zusammenspiel mit anderen Objekten (z.B. Lineal
und Zirkel, Messrute und Jakobstab) Bedeutung konstituieren. Immer wieder
setzen sie auf eine Lektüre, die Text, Diagramm, geometrisches Instrument und
praktische Übung miteinander vermittelt, bzw. sie behaupten die Notwendigkeit
einer solchen Rezeptionsweise als Voraussetzung des Verstehens.
Von der Kunstwissenschaft oder der Wissens- und Mediengeschichte sind diese
Texte zwar gelegentlich als Quellen genutzt worden, doch die Druckwerke selbst,
ihre Faktur, ihre Vertextungsmuster oder ihre genuine Rhetorizität gerieten
bisher kaum in den Blick. Wo dies punktuell dennoch geschah, wurde dabei die
von den Texten behauptete didaktische Intention a priori als primäres Ziel der
Text- und Buchgestaltung gesetzt.
Eine nähere Analyse jedoch zeigt eine heterogene Befundlage: Die von den
Druckwerken behauptete Praktikabilität wird von den Lehrschriften in sehr
unterschiedlichem Maße eingelöst, Überexplizierung und unverständliche
Verkürzung im geometrischen "Zitat", darstellerische Ökonomie und
scheinbar überflüssiger Zusatz etwa stehen immer wieder nebeneinander. Der
Kanon vorgestellter Verfahren und die Formen ihrer Präsentation adressieren
zwar eine handwerkliche Praxis, aber ebenso folgen sie einer textuellen
Traditionsbildung. Einige der Schriften scheinen dabei besonders auf
Bedürfnisse der höfischen Repräsentation zu antworten, andere weisen in das
Umfeld städtischer, humanistischer Kommunikationssituationen, wieder andere
scheinen eine Offizin und ihre Möglichkeiten besonders zu empfehlen oder
attribuieren bestimmte Wissensbestände einem Verfasser oder Widmungsempfänger.
Kurz gesagt: Es ist zu vermuten, dass die jeweilige Faktur der Schriften,
ihre multiple Adressierung, die verschiedenen Arten an Traditionen anzuknüpfen
und eigene auszubilden sowie ihre unterschiedlichen Bemühungen Wissen und Können
zu transkribieren auf eine Polyfunktionalität dieser Druckwerke verweisen, die
mit Stichworten wie "Lehrschrift", "Fachliteratur" o.Ä. zu
einem guten Teil ausgeblendet wird. Besonders solche Momente, die auf eine
spezifische und ostentativ inszenierte Ästhetik fachthematischer Druckschriften
verweisen, sind damit nivelliert. Für das Projekt leitend wird die
Arbeitshypothese sein, dass sich für die deutschen Geometrieschriften eine
handlungsanweisende didaktische Funktion und eine für vielfältige Kommunikationsinteressen
anschlussfähige "geometrische" Literarizität und Ästhetik immer neu
verschränken.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity




