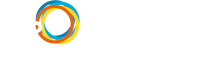Ringvorlesung "Was ist Universität?"
Ringvorlesung "Was ist Universität?"
An der Uni ankommen – ins Studium einsteigen!
In dieser Ringvorlesung beschäftigen sich externe Expertinnen und Experten sowie Lehrende unterschiedlicher geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer der Goethe-Universität mit der Frage „Was ist Universität?“.
Die Institution Universität wird aus unterschiedlichen (Fach-)Perspektiven kritisch beleuchtet und in ihrem Verhältnis zur (Stadt-/Gesamt-)Gesellschaft thematisiert. Sie erfahren so die Universität in ihren u.a. aktuellen, historischen, räumlichen und gesellschaftlichen Verschränkungen und können so selbst Ihren studentischen "Lebensraum" besser perspektivieren. Dazu verfassen Sie als Teil Ihres Portfolios im Hochschulmodul einen gleichnamigen, kurzen Essay. Ein Reader mit Lesematerial sowie Lerneinheiten der Übung Literale Kompetenzen und wissenschaftliches Arbeiten unterstützten Sie dabei.
ToDo (Anforderungen Studienordnung)
Lt. Studienordnung hat der Modulteil Ringvorlesung "Was ist Universität" 1 SWS, die Sie mit dem Besuch der Vorlesung zu den unten stehenden Terminen verbringen.
Für den Abschluss des Modulteils ist ein schriftlicher dreiseitiger Essay (ca. 5.000 Zeichen) mit dem Titel "Was ist Universität?" als Artefakt Ihres Portfolios (OLAT) notwendig. Im Modulteil Literale Kompetenzen und Wissenschaftliches Arbeiten werden Sie bei dieser Schreibaufgabe unterstützt.
Termine/Programm
Do 16-18h, 7 Termine - 18.04.-06.06.2024
Die Universität als atmosphärisches Raumgefüge
Es gibt nicht nur den dreidimensionalen Raum mit Ecken und Kanten und einem quantifizierbaren Volumen. Mit geradezu „umwölkender“ Eindrucksmacht sind Räume auch sinnlich gegenwärtig und im Medium der Gefühle spürbar. Welche Bedeutung haben atmosphärische Raumqualitäten für das Befinden in Hörsälen, Seminarräumen, Treppenhäusern, Mensen … und noch den Sanitäranlagen einer Universität?
Die Idee der Universität und die historische Entwicklung der Institution
Nicht erst heute sind Universitäten eine Reformbaustelle. Seit mindestens 200 Jahren wird über die Stellung der Universität in Staat und Gesellschaft, ihre Funktion und Aufgabe diskutiert. Soll hier in erster Linie für bestimmte Berufe ausgebildet werden? Sind sie vor allem Orte der zweckfreien Forschung? Oder Ort der Bildung und des ungestörten Nachdenkens? Stehen sie in unmittelbarer gesellschaftlicher Verantwortung und arbeiten an der Lösung der großen gesellschaftlichen Fragen?
In der Vorlesung werden die Entwicklungslinien der Institution beginnend im Mittelalter über die Bildungsreformen des frühen 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert aufgezeigt.
Universität im gesellschaftlichen Wandel
Neben Lehre und Forschung hinaus suchen Universitäten heute den Austausch mit Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. Die Universitäten öffnen sich und fühlen sich dem städtischen Gemeinwesen verpflichtet. Dabei ändert sich das Selbstverständnis der akademischen Institution: Weg vom Klischee des Elfenbeinturms und hin zu einem zentralen Organ einer offenen Wissensgesellschaft. Der Preis kann sich in ökonomischer Abhängigkeit gegenüber außeruniversitären Instanzen und Interessensgruppen niederschlagen. Was das alles bedeutet, wird vor allem am Beispiel der Stiftungsuniversität Frankfurt illustriert.
Universitäten und Nachhaltigkeit
Universitäten können auf verschiedenen Wegen zu Nachhaltigkeit beitragen: über Lehr, Forschung oder den eigenen Betrieb. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt und was sind die grossen Hebel, um Veränderungen anzustossen? Welche Rollen spielten Wissen, Technik oder gesellschaftliche Bewegungen dabei? Und wie hängen Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Lebensqualität zusammen. Diese Fragen werde ich mit Ihnen in meiner Vorlesung erörtern.
Universität queeren und postkolonisieren – Ein- und Ausschlüsse an Hochschulen
Hochschulen sind Teil gesellschaftlicher Kämpfe um Macht- und Herrschaft. In ihnen spiegeln sich Dominanzverhältnisse wider, aber sie schaffen auch widerständige Räume, in denen Alternativen imaginiert und Widerstand organisiert werden kann. In meinen Vortrag werde ich die Ein- und Ausschlüsse an Hochschulen in Deutschland geschichtlich nachzeichnen. Im Anschluss fokussiere ich zwei aktuelle Debatten: Die Frage nach dem Zugang und der Sichtbarkeit von trans*, inter* und nicht-binären Perspektiven und Personen sowie der Frage nach (post-)kolonialen Logiken an Hochschulen.Mythos
Bürgersinn. Anmerkungen zur Gründung der Universität Frankfurt
Im Jahr 2014
hat sich die Gründung der Frankfurter Universität zum hundertsten Mal gejährt.
In den offiziellen Verlautbarungen wird diese Gründung, die sich einer
kommunalen Initiative und privaten Spenden verdankt, als Ausdruck des liberalen
Frankfurter »Bürgersinns« gefeiert, der sich erfolgreich gegen die Autorität
des preußischen Staats durchgesetzt habe. Jürgen Schardt zeigt in seinem
Vortrag, dass mit dieser Universitätsgründung die staatliche Souveränität keineswegs
in Frage gestellt wurde, sondern vielmehr ein Anpassungsprozess erfolgte, bei
dem die privaten Frankfurter Stiftungen und Vereine in die Ordnung des
Deutschen Reichs integriert wurden.
Multimodale Lerning Analytics: Ein Blick in die Zukunft des Lernens an der Universität - Wie KI und Sensorik unsere Art zu lernen revolutionieren -
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihre Uhr, Ihre Brille
oder sogar Ihr T-Shirt Ihnen helfen könnte, besser zu lernen. Klingt wie
Science-Fiction? Nicht mehr lange! Wir stehen an der Schwelle zu dieser
Zukunft, angetrieben durch die neuesten
Fortschritte in der KI und der Sensorik. Diese Entwicklungen öffnen die Tür zu
völlig neuen Lernumgebungen auch an der Universität – willkommen in der Ära der
Multimodalen Learning Analytics (MMLA).
In einer Zeit, in der die digitale Transformation alle
Bereiche unseres Lebens erfasst, bietet die Bildung keine Ausnahme. Die Nutzung
von Lernmanagementsystemen und digitalen Endgeräten, und Virtual Reality
Brillen hat uns bereits neue wertvolle Einblicke in das Lernverhalten gegeben.
Doch das ist erst der Anfang. Das Internet-der-Dinge bringt eine Flut
neuer Technologien mit sich – von Wearables über tragbare Eye-Tracking-Systeme
bis hin zu programmierbaren Mikrocomputern. Diese Geräte sammeln eine Fülle von
Daten, die, wenn sie geschickt analysiert werden, das Potenzial haben, das
Lernen auf eine Weise zu unterstützen, die wir uns bisher kaum vorstellen
konnten.
MMLA nutzt diese Daten, um ein detailliertes Bild vom Lernprozess zu zeichnen. Indem sie Informationen aus verschiedenen Quellen kombiniert – sei es Text, Video, physiologische Daten oder die Analyse von Bewegungsabläufen –, ermöglicht sie ein tieferes Verständnis davon, wie wir lernen. Dieser Ansatz verspricht, individuelle Lernwege zu erkennen, und personalisertes Feedback zu geben.
Im Rahmen der Ringvorlesung „Was ist Universität?“ des Goethe-Orientierungsstudiums Geistes- und Sozialwissenschaften werden Professor Hendrik Drachsler und Dr. Daniele Di Mitiri ihr Forschungsprogramm zu MMLA vorstellen. Sie tauchen ein in die Welt, in der KI und Sensorik nicht nur unsere Bewegungen beim Lernen, Präsentieren, Sport oder Tanz erfassen, sondern diese Daten nutzen, um personalisierte Lernerfahrungen zu schaffen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Experten aus Psychometrie, Sportwissenschaften, Feedbacktheorie, Learning Design und Data Science, stellt der MMLA-Ansatz eine spannende Erweiterung in der Bildungsforschung dar.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity